Freyung/Budapest. Das Schicksal von Géza Somogyváry, den es gegen Ende des Zweiten Weltkriegs mit seinen Kameraden auf der Flucht vor der Roten Armee von der ungarischen Soldatenschule in den Bayerischen Wald verschlagen hatte, ist ein packendes sowie überaus wertvolles Stück Zeitgeschichte. Der damals 14-Jährige schilderte gegenüber dem Onlinemagazin da Hog’n, wie er im Herbst 1941 Soldatenschüler wurde, wie er zunächst von Kőszeg über Eger nach Kirchholz kam, bei Philippsreut die Grenze überschritt und in Neudorf bei Grafenau sowie wenig später in Waldhäuser landete. Im fünften und letzten Teil seines Berichts erzählt Géza Somogyváry von seinem Aufenthalt in Passau und Pocking, von wo aus er Ende Februar 1946 die Heimreise antrat.

Am 29. April 1945 marschierten Géza Somogyváry und seine Schulkameraden durch das Tor der Brauerei Lang in Freyung. Dem Hog’n hat der heute 89-jährige Ungar seine Geschichte erzählt. Screenshot: YouTube/Critical Past
Als wir im Oktober in Passau ankamen, wurde die Rückführung der ungarischen Geflohenen nach Ungarn unterbrochen. Die Wahlen in Ungarn fanden im November statt – und die Kommunistische Partei wollte nicht, dass die Kriegsgefangenen aus dem Westen nach Hause kehrten. Gegen die Rückkehr der Gefangenen aus der Sowjetunion hatte die Parteiführung hingegen nichts.
Und dann blieben wir bis Weihnachten ’45 in Passau
Unser Lager befand sich auf einem kleinen Hügel unweit der Fabrik der Waldwerke GmbH (heutiges Gelände der Zahnradfabrik ZF Friedrichshafen). Dort wurden u.a. Flugzeugteile, Getriebe für Panzer und Bunkertüren hergestellt. Bereits zum dritten Mal kamen wir in einer Baracke aus Pappkarton unter. Der Boden wurde somit wieder zu unserem „Bett“. Die Schlitze zwischen den Bodendielen waren fünf Millimeter breit. Wir nahmen Zeitungspapier, tränkten es in Wasser, zerknitterten es und stopften es in die Lücken, damit abends die Kälte nicht ins Zimmer einzog.
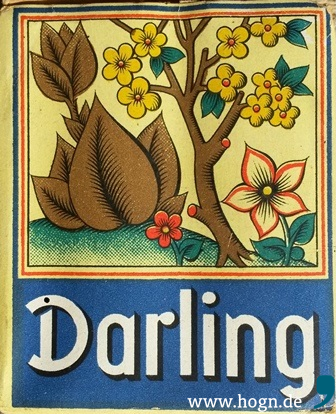
Ersatz-Währung nach dem Krieg: Zigaretten. Im Bild: Die ungarischen „Blue Darling“. Foto: dohanymuzeum.hu
Das Klo war ungefähr 100 Meter weit weg, die Essensausgabe rund 150. Wir bekamen kein Fleisch zu essen, das Brot wurde rationiert, zum Frühstück gab’s kalten Kaffee, Honig und Marmelade. Das Mittagessen bestand meist aus Kartoffeln. Alles kein Problem, dachten wir, denn in wenigen Tagen oder Wochen würden wir ohnehin nach Hause kommen. Zumindest dachten wir das. Und dann blieben wir bis Weihnachten 1945 in Passau. Uns wurden bequeme Betten mit alten Decken zugeteilt. Eigentlich war es in unserer Unterkunft verboten nachts einzuheizen, aber wir erhielten schließlich die Erlaubnis dafür.
Doch wer heizen wollte, benötigte Brennstoff. Auf dem Gelände der Aluminiumfabrik befand sich ein Haufen Holzkohle. Wir hatten uns welche geholt. Keine Ahnung woher, aber wir alle hatten in Windeseile Geld zusammengekratzt. Ich habe Geld mit dem Verkauf von Zigaretten erhalten. Ich hatte immer noch einhundert „Blue-Darling“-Zigaretten von zu Hause übrig. Meine Abnehmer waren meist Leute, die mit Schiffen der Ungarischen Fluß- und Seeschiffahrts AG (MFTR) über die Donau nach Passau geflohen waren.
Gegenüber einer Passauer Straßenbrücke befand sich der Gasthof „Zur Lindau“. Es war nicht billig, aber man konnte ein Mittagessen ohne Lebensmittelmarke kaufen. Ich aß dort jeden Tag zu Mittag – oder auf einem Schiff namens „Vulcanus“.
Am 5. Januar ging’s mit dem Zug von Passau nach Pocking
An Weihnachten erreichte uns die Nachricht, dass nun von Pocking aus der Nachhause-Transport begonnen hatte. Die Wahlen waren vorüber, die Kommunisten hatten nicht gewonnen – und die Gefangenen und Geflohenen aus dem Westen konnten nach Hause zurückkehren. Am 5. Januar verließen wir Passau mit dem Zug nach Pocking. Die Amerikaner brachten uns nicht in das größere der beiden Lager („Ungarnlager„), sondern steckten uns in das Lager nahe der Aluminiumfabrik (Vereinigte Aluminiumwerke – VAW, heute: Rottwerk). Dort sind Sozialräume mit Wänden aus Pappkarton eingerichtet worden, um diejenigen Gefangenen unterzubringen, die der SS zugehörig waren.

Géza Somogyváry (rechts im Bild) und seine Schulkameraden erhielten im Pockinger Lager täglich einen halben Liter Milch von den Amerikanern.
Kaum waren wir angekommen, kamen zwei SS-Offiziere auf uns zu. Sie waren Donauschwaben und bewegten sich so frei, als wären sie keine Gefangenen. Sie sprachen mit uns Ungarisch. Dann kam ein amerikanischer Kommandeur mit seinem Adjutanten. Sie sahen sich um, sprachen zunächst kein Wort. Als sie wieder gingen, wechselten sie doch ein paar Sätze – sie sagten irgendwas von Milch. Um fünf Uhr nachmittags kam ein deutsches Auto und brachte eine Krug Milch vorbei. Wir erfuhren, dass der amerikanische Kommandant angeordnet hatte, uns Schülern täglich einen halben Liter Milch zu geben. Der Milchwagen kam von nun an jeden Nachmittag um 17 Uhr. Fast jeder trank die Milch sogleich in einem Satz. Die Disziplin war völlig gebrochen. Die Jüngsten unter uns fingen an mit den Gerätschaften der Fabrik herumzuspielen. Es war etwa ein großer Spaß auf den Ofen zu klettern und ihn anzuschalten. Unfälle gab es keine.
Am 25. Januar 1946 betrat ich schließlich das große Lager Pocking („Ungarnlager“). Ungefähr 100.000 ungarische Menschen waren dort untergebracht. Ich weiß bis heute nicht, wie der Ort sie alle verkraften konnte. Dort gab es zwei ungarische Busse, die zwischen dem Bahnhof und dem Lager verkehrten. Sogar die Straßen in dem Lager erhielten ungarische Namen und Schilder. Es gab ein Theater, in denen Künstler auftraten, eine Vielzahl von Geschäften. Ich verkaufte meine restlichen Zigaretten und blickte auf all das zurück, was ich gesehen und erlebt hatte. Am 23. Februar 1946 ging ich zurück zur Aluminiumfabrik und machte mich für die Heimreise am nächsten Tag bereit.
Auf der einen Seite die Amis, auf der anderen die Russen
Wir hatten bereits Übung beim Packen. Am 24. Februar 1946, um 7 Uhr, waren wir bereit für die Abfahrt. Voller Aufregung gingen wir zu Fuß zum Pockinger Bahnhof, wo wir etwas zu essen bekamen (u.a. Kartoffelflocken und etwas Wurst). Am Bahnhof standen etliche ungarische Waggons. Es gab aufgrund des nahegelegenen Flughafens und der verschiedenen Fabriken viele Gleise.

Die Kossuth-Brücke in Budapest, fotografiert im Jahr 1957. Foto: Fortepan.hu / Wikipedia: CC BY-SA 3.0
Der uns zugewiesene Güterwagen befand sich in einem schrecklichen Zustand: Schlitze auf dem Boden und an den Seitenwänden. Wir wussten, dass wir unterwegs etwas Kohle benötigen würden und fragten uns, wie wir es in diesem Waggon aushalten würden – mit 36 Schülern und drei Lehrern. Wir tauschten deshalb den Waggon, jedoch unterlief uns ein Fehler beim Ankuppeln – und wir blieben stehen. An diesem Tag setzten wir uns also nicht in Bewegung und kehrten vorerst wieder zurück in den alten Güterwagen. Abends zogen wir in einen Personenwagen um, den wir erneut eigenständig ankuppelten. Diesmal hatten wir es richtig gemacht. Aus dem benachbarten Waggon lächelte uns die US-Wache zu.
Tags darauf sind wir nach Hause aufgebrochen. In zwei Tagen hatten wir die Enns in Österreich erreicht, wo sich die Grenze zwischen der amerikanischen und der sowjetischen Besatzungszone befand: auf der einen Seite des Flusses aßen elegante, amerikanische Soldaten Orangen, auf der anderen rauchten die Sowjets Mahagonigewächse in russisches Zeitungspapier gewickelt.
Über St. Pölten ging es dann weiter nach Wien. Die Haltestelle sah recht friedlich aus. An der ungarischen Grenze hatte man uns mit einer leckeren Bohnensuppe und Weißbrot empfangen – es war ein Gedicht! Doch was wir dann sahen, brachte uns an den Rande der Verzweiflung: eine kilometerlange Schlange ausgebrannter Waggons, der Bahnhof von Hegyeshalom, ein Ort an der ungarisch-österreichischen Grenze, war zerstört. Aber wir waren wieder in der Heimat.
Niemand wusste, dass ich nach Hause kommen würde
In Komárom umzingelten Polizisten den Zug. Erst am nächsten Morgen, 6 Uhr, fuhren wir weiter an den Ruinen des Südbahnhofs vorbei. In Budapest ging ich schließlich zu Fuß zur Donau hinunter und sah, was ich bereits ahnte: alle Brücken lagen in Trümmern – bis auf die Kossuth-Brücke. Ich überquerte den Fluss mit einem kleinen Motorboot, das mich mitnahm. Am anderen Ufer stieg ich in die Trambahn nach Pesterzébet.
Zuhause angekommen, war die Überraschung und die Freude groß. Niemand wusste, dass ich an diesem Tag nach Hause kommen würde. Es war der 3. März 1946, der Tag meiner Rückkehr. Meine Mutter rief ein Taxi, wir beide fuhren zurück zum Bahnhof, wo wir meinen Rucksack abholten. Ich verabschiedete mich von meinen Begleitern, die sich noch dort befanden – und wir fuhren wieder nach Hause.
Die Odyssee war vorbei.
da Hog’n












































