
Mit „Gebrauchsanweisung für Prag und Tschechien“ liefert Martin Becker seine persönliche Liebeserklärung an seine zweite Heimat. Foto: Ekko von Schwichow, www.schwichow.de
Der Leipziger Schriftsteller Martin Becker tritt in große Fußstapfen: Als Verfasser der neu im Piper-Verlag erschienenen „Gebrauchsanweisung für Prag und Tschechien“ tritt er die Nachfolge von Jiří Gruša an, der im Jahr 2000 die erste tschechische „Gebrauchsanweisung“ für den Piper-Verlag geschrieben hatte. Gruša wurde als Dissident vom kommunistischen Regime der Tschechoslowakei verfolgt; später wurde er Botschafter der Tschechischen Republik in Deutschland. Der 1982 geborene Martin Becker studierte am Leipziger Literaturinstitut. Seit seinem Abschluss arbeitet er als Journalist und Buchautor. 2014 erschien sein erster Roman „Der Rest der Nacht„. So unterschiedlich die Biographien der beiden Autoren, so verschieden lesen sich auch deren „Gebrauchsanweisungen“. Gruša, der Tscheche, der Deutschland liebte, schrieb sie als Kulturgeschichte seines Herkunftslandes; Becker, der Deutsche, der Tschechien liebt, schreibt sie als Liebeserklärung an eine zweite Heimat.
Wo die Hipster von heute auf den Prager Underground treffen
Bei seiner literarischen Reise ins Nachbarland verzichtet Becker weitgehend auf das Offensichtliche: Die Reise nach Prag beginnt nicht etwa an der faszinierenden astronomischen Uhr auf dem Altstadtring oder auf der Prager Burg, wo im 17. Jahrhundert jener berüchtigte Fenstersturz geschah, der den Dreißigjährigen Krieg auslöste. Stattdessen nimmt Becker seine Leser zu Beginn der Gebrauchsanweisung mit in ein Krankenhaus am Stadtrand, weit weg von jenen Sehenswürdigkeiten, denen die Moldau-Metropole ihr Pseudonym als „Goldene Stadt“ verdankt. Dort nämlich landete der heute 33-Jährige vor vielen Jahren bei seinem ersten Prag-Besuch – natürlich unfreiwillig. Erst später erfuhr er, dass sich im selben Krankenhaus ein international weniger berühmter, für die tschechische Kulturgeschichte jedoch nicht minder einschneidender Fenstersturz der Neuzeit ereignet hatte: Hier fiel Bohumil Hrabal, der heute als bester tschechischsprachiger Schriftsteller der Moderne verehrt wird, im Jahr 1997 aus dem Fenster seines Krankenzimmers – ob es sich dabei um einen Unfall beim Taubenfüttern oder um Suizid handelte, gilt als eines der großen tschechischen Rätsel der Neuzeit.
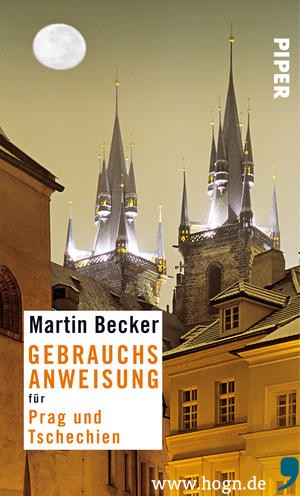 So erzählt Becker von der Geschichte und Kultur des Landes eher indirekt, indem er sie mit eigenen Erfahrungen und Begegnungen im Jetzt verknüpft. Becker verweilt bei seinen Prag-Besuchen, wo früher Franz Kafka an seinem Kaffee schlürfte – und begegnet dabei der heutigen Prager Prominenz aus Politik und Gesellschaft. Er weiß aber auch, wo man noch heute auf die Dissidenten von einst treffen kann: In den Kneipen in den Prager Stadtteilen Vršovice und Žižkov kommen, so schwört Becker, Hipster von heute und der Prager Underground von damals zusammen.
So erzählt Becker von der Geschichte und Kultur des Landes eher indirekt, indem er sie mit eigenen Erfahrungen und Begegnungen im Jetzt verknüpft. Becker verweilt bei seinen Prag-Besuchen, wo früher Franz Kafka an seinem Kaffee schlürfte – und begegnet dabei der heutigen Prager Prominenz aus Politik und Gesellschaft. Er weiß aber auch, wo man noch heute auf die Dissidenten von einst treffen kann: In den Kneipen in den Prager Stadtteilen Vršovice und Žižkov kommen, so schwört Becker, Hipster von heute und der Prager Underground von damals zusammen.
„Ungeprüfter Touristenführer“
Dass es ihm vor allem die junge und alternative Szene des Landes angetan hat, demonstriert Becker in den Ausflügen, die er mit seinen Lesern unternimmt: Nach Brno etwa, der unterschätzten Hauptstadt Mährens; oder nach Ostrava, der noch viel unterschätzteren Industriestadt im Osten Tschechiens, die wegen der Luftverschmutzung und hohen Arbeitslosigkeit einen schlechten Ruf genießt – und mit ihren alten Fabrikgeländen, die allmählich von Künstlern und jungen Kreativen erobert werden, dennoch zu Beckers Lieblingsorten in Tschechien zählt.
Wer einen klassischen Reiseführer für Tschechien sucht, sollte sich einen klassischen Reiseführer kaufen. Wer den neuen tschechischen Underground kennenlernen will, ist mit dem „ungeprüften Touristenführer“, wie Becker sich nennt, bestens bedient.
Isabelle Daniel
Martin Becker, Gebrauchsanweisung für Prag und Tschechien, Piper-Verlag 2016, 221 Seiten, Preis: 15,00 Euro.
_________________________________
Martin Becker im Hog’n-Interview: Fernbeziehung mit Prag
Martin Beckers „Gebrauchsanweisung für Tschechien und Prag“ ist kein typischer Reiseführer. Was unbedingt gesagt werden muss, aber ebenso erwartbar ist, handelt Becker in wenigen Sätzen ab. Das Vokabular zum Beispiel: „Ahoj heißt Hallo. Ahoj heißt Auf Wiedersehen. Pivo heißt Bier. Láska heißt Liebe.“ Um die Liebe geht es in Wirklichkeit in Beckers Gebrauchsanweisung. Im Hog’n-Interview erklärt der Autor, wie die Liebe zu einer anderen Stadt funktioniert – und was ihn mit Blick auf Tschechien mit Sorge erfüllt.
Martin: Im Vorwort deiner „Gebrauchsanweisung für Prag und Tschechien“ gestehst du, dass du, obwohl du die Stadt sehr liebst, nie länger in Prag gelebt hast. Warum eigentlich nicht?
Das hat sich tatsächlich nie so richtig ergeben! Ich habe immer mit dem Gedanken gespielt, für längere Zeit in Prag zu leben – letztlich ist es aber immer bei einigen Wochen geblieben. Das ist aber vielleicht gar nicht so schlecht, ich merke immer wieder deutlich, dass die Liebe zu Prag bestenfalls als eine Art Fernbeziehung funktioniert. Wenn wir uns sehen, dann ist es meist nicht so lang, dafür aber sehr intensiv. Und bevor sich der wirkliche Alltag einschleicht und die Probleme mir zu viel werden, fahre ich lieber wieder weg und freue mich aufs nächste Mal. Nicht zuletzt hat es aber auch mit meiner Arbeit zu tun: Ich bin fürs Radio sehr häufig an sehr vielen verschiedenen Orten unterwegs – und wenn mal ein bisschen Luft ist, dann brauche ich die Zeit auch, um am Leipziger Schreibtisch zu arbeiten. Aber ich habe durchaus den Plan, es irgendwann noch zu tun: Mir ein Zimmer in Prag zu suchen und vielleicht ein halbes Jahr zu bleiben. Dann wird sich zeigen, ob die Fernbeziehung auch als Nahbeziehung funktioniert…
„Von Havels Geist ist derzeit nicht mehr viel übrig – traurig“
Du schreibst in der Gebrauchsanweisung recht wenig über die tschechische Politik. Warum?
Das hat verschiedene Gründe. Einerseits ist die Politik derzeit ja sehr tagesaktuell, die Gebrauchsanweisung hingegen soll in dieser Form durchaus mehrere Jahre lang Gültigkeit haben. Andererseits hätte ich es anmaßend gefunden, mich zur Politik in Tschechien wirklich umfassend zu äußern. Dazu, so zumindest mein Gefühl, kenne ich mich dann doch zu wenig aus. Aber es gibt ja durchaus schon einige Spitzen gegen den amtierenden Präsidenten, auch einige abenteuerliche Vorgänge im politischen Geschäft werden angesprochen – ich gebe also den Leserinnen und Lesern zumindest einige Stichworte, auf deren Grundlage sie sich dann selbst ein Bild machen können.
Was gibt es aus deiner Sicht zur aktuellen tschechischen Politik zu sagen?
Wie gesagt, sofern ich das von meiner Position aus beurteilen kann, machen mich viele Vorgänge schon sehr traurig. Ich habe dieses Jahr ein einstündiges Feature über Václav Havel gemacht und viele ehemalige Weggefährten interviewt – die aktuelle Situation mit den Ausfällen eines Präsidenten Zeman und einer insgesamt doch eher xenophoben Grundstimmung sind ja nicht gerade ein Grund zum Optimismus. Es klingt vielleicht naiv, aber ich habe mich im Laufe der Arbeit öfters gefragt, was eigentlich von Havels Geist noch übrig ist: Offenkundig derzeit nicht mehr viel – und das ist schon sehr tragisch.

„Warum haben die Tschechen im Nationalsozialismus eigentlich keinen Widerstand geleistet? – Weil die Deutschen es nicht erlaubt haben.“
Jaroslav Rudiš, der in deiner „Gebrauchsanweisung“ als guter Freund und Schriftstellerkollege ja auch prominent auftritt, hat mir mal den folgenden Witz erzählt: „Treffen sich zwei Polen. Fragt der eine den anderen: ‚Warum haben die Tschechen im Nationalsozialismus eigentlich keinen Widerstand geleistet?‘ Sagt der andere: ‚Weil die Deutschen es nicht erlaubt haben.'“ Stimmt es, dass die Tschechen politisch eher passiv sind?
Das würde ich so nicht sagen. Die Freundinnen und Freunde aus meiner Generation haben schon ein reges Interesse am politischen Diskurs und gestalten ihn teilweise sogar aktiv mit. Eine Freundin von mir ist beispielsweise sehr umtriebig in der alternativen Szene von Brno und initiiert immer wieder Aktionen, auch öffentlichkeitswirksam. Vielleicht gibt es insgesamt eine gewisse Müdigkeit und Verdrossenheit – was mich allerdings nicht wundert angesichts der vielen Skandale in den letzten Jahren.
„Mein Geheimtipp Nummer eins ist und bleibt: Ostrava“
Das böhmisch-bayerische Grenzgebiet spielt in deiner „Gebrauchsanweisung“ keine große Rolle. Verbindest du dennoch etwas mit der Region?
Ich persönlich kenne die Gegend nicht, weiß aber doch sehr viel über sie – das klingt paradox, hat aber einen wunderbaren Grund: Während meines Studiums am Leipziger Literaturinstitut war der Oberpfälzer Schriftsteller Werner Fritsch einer meiner Dozenten. Sein Buch „Cherubim“ habe ich – neben vielen anderen Arbeiten von ihm – sehr gemocht. Und er wiederum hat ja auch eine sehr enge Beziehung nach Tschechien und hat beispielsweise ein Lesebuch über Böhmen herausgegeben. Insofern ist mir die Gegend eher aus Gesprächen mit Werner Fritsch bekannt – aber das wird sich sicher in den nächsten Jahren noch ändern.
Welcher Ort in Tschechien ist außerhalb Prags dein Lieblingsort?
Das ist nicht so leicht zu beantworten – darf ich mir mehrere Lieblingsorte aussuchen?
Aber gern.
Da ist natürlich zuerst die Berounka; es gibt einige Orte in Mittelböhmen, die ich sehr liebe. Ich habe mal eine Reportage über Ota Pavel geschrieben, dessen Geschichten ja teilweise an der Berounka spielen – eine unglaublich schöne Gegend, und gar nicht weit entfernt von Prag. Auch das Altvatergebirge hat es mir sehr angetan – dort war ich für ein Radiofeature zusammen mit meinem guten Freund Jaroslav Rudiš vor einigen Jahren mal. Und was andere Städte angeht: Brno mag ich wirklich gern, vielleicht auch, weil die Stadt gewisse Ähnlichkeiten zu meinem derzeitigen Wohnort Leipzig hat.
Aber mein Geheimtipp Nummer eins, allen Vorurteilen zum Trotz, das ist und bleibt: Ostrava. Ich bin immer wieder gern dort und liebe den rauen Charme der Stadt sehr. Kurz gesagt, die Zeit reicht eigentlich nie, um bei jedem Besuch tatsächlich alle Lieblingsorte zu besuchen – denn noch dazu gibt es ja auch sehr viele Lieblingsmenschen in Tschechien, die ich auch immer gern sehen möchte.
Interview: Isabelle Daniel
















































