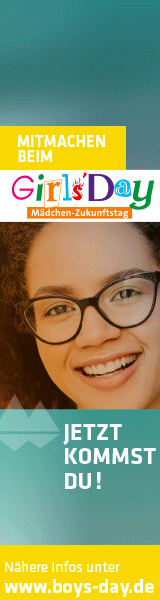Köln/Viechtach. Im Jahr 2050 wird es um die zehn Milliarden Bewohner auf der Erde geben. Dass jeder einzelne aus dieser Fülle von Menschen satt wird, daran glaubt 35 Jahre zuvor angesichts der heutigen Verhältnisse wohl niemand. Autor und Regisseur Valentin Thurn („Taste the Waste„) beschäftigt sich in seinem neuen Dokumentarfilm „10 Milliarden – werden wir alle satt?“ mit der Frage, wie künftig ausreichend Lebensmittel für die stetig wachsende Weltbevölkerung erzeugt werden können – und bietet Lösungsansätze. Nicht dazu gehören die „Fleischfabriken“, in denen Tiere am Fließband geschlachtet und verarbeitet werden.

„Wie können wir verhindern, dass die Menschheit allein durch ihr Wachstum die Grundlage für ihre Ernährung zerstört?“ Valentin Thurn (52), Regisseur aus Köln, beschäftigt sich in seinem neuen Dokumentariflm, der seit 16. April bundesweit in den Kinos zu sehen ist, mit dieser Frage. Foto: Monika Nonnenmacher
„Sinn machen kleinere, lokale Lösungen anstelle der großen“
„10 Milliarden – wie werden wir alle satt?“ lautet der Titel Ihres neuen Filmprojekts. Wir geben die Frage sogleich an Sie weiter: Wie werden wir denn alle satt, Herr Thurn?
Der Film gibt keine pauschale Antwort auf diese Frage. Fakt ist: Wir haben bisher auf große Lösungen gebaut, frei nach dem Motto: Der Weltmarkt wird’s schon richten. Doch ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Es wird immer unsicherer, je stärker wir uns auf die ganz großen Lösungen verlassen. Ernährungssicherheit erlangen wir nur, wenn wir auf kleine, lokale Lösungen setzen. Die sind es doch, die momentan das Rückgrat der Welt-Ernährung bilden. Und wenn wir uns weiter davon entfernen, sorgen wir nur für mehr Unsicherheit.
Trailer zu Valentin Thurns Dokumentarfilm „10 Milliarden – wie werden wir alles satt?“:
Was ist unter den „kleinen Lösungen“ genau zu verstehen?
Zum Beispiel die Kleinbauern. Das ist kein Begriff, den wir für die Landwirtschaft hierzulande verwenden würden. Natürlich gibt es auch bei uns kleinere und mittlere Bauernhofgrößen – doch damit sind eher die landwirtschaftlichen Betriebe in den Entwicklungsländern gemeint, die noch weitgehend ohne Mechanisierung arbeiten. Man hat einmal gesagt, dies sei völlig unmodern und könne nicht funktionieren. Tatsächlich ist es aber immer noch so, dass zwei Drittel der Weltbevölkerung von diesen Kleinbauern ernährt werden – inklusive der großen Mega-Citys wie Lagos. Die Kleinbauern sitzen sie an den Rändern von Zehn-Millionen-Metropolen, produzieren Milchprodukte, Gemüse und alles, was frisch sein sollte.
Es macht viel Sinn, hier unterstützend einzuwirken – anstatt zu sagen, dass es sich um eine Landwirtschaftsform von vorgestern handele. Man sollte erkennen, dass die Kleinbauern unterm Strich mehr aus dem Hektar Land herausholen können als die Großfarmer. Das liegt daran, dass sie arbeitsintensiver wirtschaften und auf einem Feld zum Beispiel drei Pflanzen nebeneinander wachsen lassen. Das funktioniert jedoch nur mit manueller Arbeit. Die Studien sind relativ eindeutig: Wenn wir davon ausgehen, dass wir weltweit begrenzte Ackerflächen haben, dann ist es keineswegs die großtechnische Landwirtschaft, die aus dieser begrenzten Fläche mehr herausholen kann, sondern die kleine – mit mehr Arbeitskraft, das ist klar.
„Bringt nicht viel, weile die Handelspolitik alles zunichte macht“
Wie ist die Situation bei uns in Europa?
In Europa ist das schon eine andere Nummer: Wir haben ja die Situation, dass wir hier mit biologischer Landwirtschaft im Schnitt 25 Prozent weniger aus einem Hektar herausholen als die konventionelle Landwirtschaft. Das liegt daran, dass sie genauso wie die konventionellen Bauern mit viel Mechanisierung ran müssen – das könnte sonst keiner mehr bezahlen. Und deswegen kann man das, was da in der Dritten Welt passiert, nicht mit unseren europäischen Augen betrachten – hier herrschen andere Bedingungen.

„Und deswegen kann man das, was da in der Dritten Welt passiert, nicht mit unseren europäischen Augen betrachten.“ Foto: © 2015 Prokino
Was aber nicht heißt, dass die Kleinbauern in Asien oder anderswo Subsistenz-Bauern bleiben sollen. Sie brauchen Zugang zu Land, Zugang zu Wasser, aber auch Zugang zu den Märkten. Und auch die Technik ist wichtig, klar. Es geht nicht nur darum, dass sie sich selbst ernähren können, sondern ganz im Gegenteil: Sie sollen durchaus am Markt teilnehmen. Genau das hat die Entwicklungshilfe auch langsam begriffen.
Tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Es bringt nur nicht viel, weil unsere Handelspolitik alles zunichte macht, was die Entwicklungspolitik alles herumrepariert. Unsere Handelspolitik sorgt dafür, dass afrikanische Länder, die Kakao oder Bananen zu uns exportieren wollen, zur Bedingung macht, dass unsere hochsubventionierten Produkte im Gegenzug in diese Länder exportiert werden. Deswegen macht Milchpulver aus Deutschland Bauern in Malawi platt, die zuvor Milch produziert haben.
In Großstädten wie Detroit wird ja immer mehr in den Vororten bzw. sogar in der Stadt selbst Gemüse und Obst angebaut, um den Nahrungsbedarf der Leute zu decken – in Ihrem Film ist ja eine ähnliche Situation zu sehen, in Milwaukee.
Ja, da gibt es riesige Brachen mitten in der Stadt, die jetzt von den Bürgern als Anbauflächen genutzt werden.
„Man weiß heute ja gar nicht mehr, wo was genau herkommt“
Wie sind Sie denn eigentlich auf das Thema Ihres Films gekommen?
Mein neuer Film ist eigentlich eine Folge des Dokumentarfilms ‚Taste the Waste‘, den wir 2011 gedreht haben. Die Diskussionen mit dem Publikum, die sich im Anschluss daran ergeben haben, begannen beim Mindesthaltbarkeitsdatum und endeten beim Welthunger. ’10 Milliarden‘ war also quasi wie ein Publikumsauftrag – die Menschen verlangten mehr oder weniger danach, dass wir einen Film über die Produktion von Lebensmitteln und die Landwirtschaft als Basis der Welternährung machen.
Wie lange haben Sie für das Projekt gebraucht?
Insgesamt drei Jahre hat’s gedauert, bis alles fertig war. Das Drehen selbst hat sich über ein Jahr hingestreckt. Der Schnitt dann nochmal ein Jahr. Davor gab’s einen längeren Rechercheprozess und das Schreiben des Drehbuchs.
Wie ist denn die bisherige Resonanz auf „10 Milliarden“ ausgefallen?

„Unser Film ist jetzt keine Katastrophen-Lyrik. Wir haben vielmehr das Problem von der Lösungsseite her betrachtet.“ Foto: © 2015 Prokino
Ich bin sehr zufrieden – wo ich hinkomme, sind die Säle ausverkauft. Im Kino hatten wir bisher mehr als 40.000 Zuschauer, was für Dokumentarfilme nach nur ein paar Monaten Laufzeit ein sehr gutes Ergebnis ist.
Was denken Sie: Warum haben Sie den Nerv so vieler Menschen getroffen?
Es gibt ein weltweites Unbehagen gegenüber anonymen Methoden unserer Lebensmittelproduktion und -verteilung. Man weiß heute ja gar nicht mehr, wo was genau herkommt. Durch verschiedene Skandale wurden zwar einige Dinge aufgedeckt, aber man weiß dennoch nicht, was man dagegen machen soll.
Unser Film ist jetzt keine Katastrophen-Lyrik. Wir haben vielmehr das Problem von der Lösungsseite her betrachtet – und zum anderen haben wir uns sehr konkret mit der Frage beschäftigt: Was kann jeder für sich tun? Darauf baut auch die Plattform „tasteofheimat.de“ auf, über die man sich über regionale Lebensmittel-Erzeuger informieren kann. Jeder, der einen Hofladen oder einen anderen regionalen Verkaufspunkt hat, kann sich hier entsprechend eintragen.
„Die Beziehung zu Lebensmitteln ist uns abhanden gekommen“
Was kann denn jeder Einzelne tun, um mit Lebensmitteln gewissenhafter umzugehen?
Jeder hat für sich so seine Möglichkeiten – als Großstädter macht es sicherlich weniger Sinn, einen Hofladen aufm Land aufzusuchen. Da wäre die Distanz zu groß. Sinnvoller ist es hier, eine Verbraucher-Erzeuger-Gemeinschaft zu gründen – wie etwa die Food-Assembly oder die solidarische Landwirtschaft.
Wer etwas näher am Erzeuger dran ist, kann auch direkt bei ihm kaufen, klar. Tatsächlich nutzt es auch – und zwar aus einem ganz anderen Grund, als man vielleicht denkt – im eigenen Garten selber Gemüse und Obst anzubauen. Da geht’s nicht drum, einhundert Prozent seiner gesamten Ernährung aus dem eigenen Garten zu holen – aber wenn man nur einen Teil seiner Ernährung daraus deckt, ist das schon fortschrittlich.
Die Kinder lernen ja auch damit. Sie bauen dadurch eine Beziehung zu Lebensmitteln auf, eine Beziehung, die uns im Laufe der Zeit abhanden gekommen ist – und wir zunehmend weiter verlieren. Darum geht’s eigentlich. Die Menschen konsumieren dann auch anders, weil sie wieder eine Wertschätzung für Lebensmittel entwickeln.
„Hektik der Zeit führt letztlich zum Verlust der Esskultur“
Welche Rolle spielt denn dabei eine Institution wie die Schule? Welche die Eltern?
Eine sehr große Rolle. Die Situation ist leider häufig schon auf dem Land so, dass die Eltern nicht mehr selbst kochen. Und wie sollen sie’s dann den Kindern beibringen? Das ist aber eine der Basics – ohne die Kulturtechnik Kochen ist man ja gar nicht mehr in der Lage, sich ums Essen richtig zu kümmern. Das, was man beim Erzeuger direkt kaufen kann, ist ja meistens nicht verarbeitet… das Kochen ist eine Kultur-Technik, die durch die Hektik unserer Zeit verdrängt wird – und letztendlich zum Verlust der Esskultur führt.

„Der Lerneffekt ist viel höher, wenn auch der praktische Bezug hergestellt wird.“ Foto:© 2015 Prokino
Wenn man Convenience-Food im Supermarkt kauft, ist es portioniert – und es bleibt was übrig. Man kann noch nicht einmal die Reste verarbeiten. Es geht also wirklich darum, dass man in den Schulen ganz praktisch den Spaß am Kochen vermittelt – und vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Es gibt so schöne Konzepte wie die GemüseAckerdemie, das mehr als nur ein Schulgarten ist. Das ist ein ganzer Acker in der Nähe von Schulen, auf dem eine Schulklasse mit Unterstützung eines professionellen Gärtners ein Jahr lang verschiedene Gemüsesorten anpflanzt, diese erntet und im Anschluss in der Küche verarbeitet. Die Schüler bekommen also den gesamten Zyklus mit – und ein Jahr drauf darf dann die nächste Schulklasse ran.
Theorie alleine reicht also nicht aus, es geht auch ums Praktische.
Es ist ja eine Vermittlung von Dingen, die man sehr viel besser aufnehmen kann, wenn man’s praktisch macht. Natürlich gibt es Sachen, die man im Unterricht lernen kann – aber der Lerneffekt ist viel höher, wenn auch der praktische Bezug hergestellt wird.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Thurn. Und alles Gute für die Zukunft.
Interview: Stephan Hörhammer
–> Dem Film vorausgegangen ist ein Buch mit dem Titel „Harte Kost“, verfasst von Valentin Thurn und Stefan Kreutzberger. Ein hörenswerter BR-Radio-Beitrag ist unter folgendem Link abrufbar: GemüseAckerdemie