Grafenau/Schlag. Das Jahr 2013 hatte beim Wetter bislang einige Kapriolen zu bieten: Erst das Jahrhunderthochwasser, dann die anhaltende Hitzewelle. Wie sich das auf den bisherigen Ernteschnitt der regionalen Landwirte ausgewirkt hat – und wie die Prognose für die noch bevorstehende Ernte lautet, darüber spricht der aus Schlag bei Grafenau stammende Land- und Forstwirt Josef Braumandl vom Mattheishof im Hog’n-Interview.

„Die Heuernte ist gut gelaufen, da sind wir gut durchgekommen“, zeigt sich Land- und Forstwirt Josef Braumandl aus Grafenau zufrieden. Fotos: da Hog’n
Kälte, Regen, Trockenheit: Auf den Zeitpunkt der Ernte kommt es an!
Herr Braumandl, seit wann ist Ihr Hof in Familienbesitz?
Der Hof ist seit 1624 urkundlich erwähnt – lückenlos. Er ist jedoch vermutlich noch älter. In unsere Hofstelle sind wir 2001 eingezogen. Der Betrieb hat sich relativ gut weiterentwickelt bei der Milchwirtschaft. Vorher waren wir vielseitiger, heute haben wir überwiegend Milchvieh.
Und wie sieht es mit dem Ackerbau aus?
Wir bewirtschaften überwiegend Grünland – für unsere Milchkühe. An die 70 bis 80 Kühe und Kälber haben wir insgesamt. Neben den rund 80 Prozent Grünland betreiben wir zudem auf etwa 20 Prozent unserer landwirtschaftlichen Flächen Ackerbau – dabei handelt es sich überwiegend um den Anbau von Silomais. Ein Drittel davon ist Getreide, zum größten Teil Sommergerste. Neben dem Grünfutter wird noch Gerste und gentechnikfreies Soja an das Milchvieh verfüttert. Die Milch wird verkauft, der Rest wird verdüngt. Wir nutzen keinen mineralischen Dünger, sondern versuchen einen möglichst eigenen Kreislauf zu schaffen.
Wie sieht es denn mit der Ernte in diesem Jahr aus? Wie sind Ihre Prognosen?
Am Anfang des Frühjahrs war es relativ kalt – der März sogar sehr kalt. Im April und auch im Mai lagen wir etwas unterhalb des Temperaturdurchschnitts. Dann kam der Regen. Zwischendurch haben wir das erste Grün geerntet. Der Ertrag war zwar regional sehr unterschiedlich, aber bei uns recht gut.
Danach haben wir die Heuernte gemacht, den so genannten ersten Schnitt. Wir hatten einen guten Zeitpunkt erwischt – und deshalb war die Ernte von der Qualität und Menge her sehr ertragreich. Nach der Regenperiode, in der ersten Juliwoche, kam der zweite Schnitt. Wettermäßig haben wir auch den gut erwischt. Die Heuernte ist also gut gelaufen.
Danach kam die Trockenheit, wodurch die Sommergerste recht unterschiedlich ausgefallen ist – sowohl was das Getreide als auch das Stroh anbelangt. Das Stroh ist für uns deswegen so wichtig, weil wir die Kälber damit füttern. Vor allem an den Waldrändern, auf den feuchten und schweren Böden, fiel der Ertrag sehr schlecht aus. Der Boden war durch die Dürreperiode stark ausgetrocknet, weshalb nicht so viele Nährstoffe verfügbar waren.
„Dem Mais mangelte es an Wasser, als er es brauchte“
Wie viele Schnitte werden denn pro Jahr gemacht?
Beim Grünland streben wir vier Schnitte an. Insgesamt werden jeweils 70 Prozent geschnitten. Der dritte Schnitt war heuer recht problematisch: Durch die lange Trockenzeit mussten wir rund 50 Prozent Einbußen hinnehmen. Mitte Oktober wird dann der vierte Schnitt fällig: Da erwarten wir allerdings gute Erträge, denn es ist warm und die Wiesen sind grün.

Auf dem Mattheishof wird überwiegend Milchwirtschaft betrieben. An die 70 bis 80 Kühe und Kälber besitzt Landwirt Josef Braumandl.
Und der Mais?
Zuerst war es ja sehr nass – was dem Mais nicht sonderlich zuträglich ist. In der Trockenzeit konnte er sich jedoch gut erholen. Nur: Die Trockenperiode hat viel zu lange gedauert. Dem Mais mangelte es an Wasser, als er es brauchte – und nachwässern ist für uns nicht rentabel. Auch hier waren aufgrund der Trockenheit nicht genügend Nährstoffe verfügbar – und so ist der Mais in die Notreife gegangen.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Mais sehr weit fortgeschritten. Das Wachstum ist nicht allzu gut, er ist rund 50 bis 60 Zentimeter zu kurz, was sich dementsprechend auf die Kolbenbildung auswirkt. Gute Maissorten und Züchtungen haben drei Kolben pro Maisstaude. In diesem Fall sind aber nur eineinhalb bis zwei Kolben pro Staude ausgebildet. Wirklich absehen können wir das aber erst Mitte bis Ende September – aber wir rechnen schon jetzt mit 40 bis 50 Prozent Einbußen beim Silomais.
Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Silo- und Körnermais?
Beim Körnermais geht es – wie der Name schon sagt – nur um die Kolben. Die Pflanze ist so gezüchtet, dass ein Großteil der Energie in den Körnern gelagert wird. Beim Silomais geht es um die gesamte Pflanzenmasse. Wir haben überwiegend Silomais, weil sich unser Boden durch das hiesige, raue Klima besser dafür eignet. Hier erwarten wir, wie gesagt, rund 40 bis 50 Prozent Einbußen. Beim Körnermais rechnen wir mit Verlusten von 30 Prozent, beim Getreide verhält es sich ähnlich.
„Wir können gar nicht so viel Holz ernten, wie wir verkaufen könnten“
Beim Stichwort Regenperiode denkt man vor allem an die Hochwasserkatastrophe vor einigen Monaten. Inwiefern wirkt sich das auf die Ernte aus?
In der Hinsicht haben wir Glück gehabt. Der Bach hier in der Nähe ist zwar angeschwollen, aber nicht allzu stark übergetreten. Außerdem wurde die Hochwasser-Gefahr beim Bau des Hofes berücksichtigt. Der Hof ist so angelegt, dass dies kein großes Thema ist. Die Wiesen waren zwar etwas überschwemmt – teilweise waren Maisflächen betroffen -, aber wie schon erwähnt: Der Mais konnte sich davon gut erholen.
Die Ackerflächen wurden so angelegt, dass im Falle eines Hochwassers möglichst nur Grünland betroffen ist. Wir können uns also nicht beklagen.
Wie geht es nach der Ernte im Winter weiter?
Neben der Milchwirtschaft beschäftigen wir uns mit Waldwirtschaft. Ab November ist die Landwirtschaft gelaufen, dann kümmern wir uns um die Aufforstung, also die Naturverjüngung.
Wie geht es dem Wald denn?
Der Wald hat sich in den vergangenen zwei Jahren gut erholt. Seit den letzten vier Wochen ist der Borkenkäfer jedoch wieder auf dem Vormarsch. Das ist eine Gefahr. Dabei ist die zweite Brut Käfer weitaus gefährlicher als die erste. Wenn diese Überhand nimmt, kommt es zu Schäden im Spätherbst oder im darauf folgenden Frühjahr. Ansonsten ist der Holzmarkt für unsere Waldbauern gut. Holz erzielt derzeit einen guten Preis. Wir können gar nicht so viel ernten, wie wir verkaufen könnten.
Für welche Zwecke wird das Holz verkauft?
Der wichtigste Faktor ist die Produktion von Hackschnitzeln zur Wärmegewinnung. Verschiedene Schulen haben zum Beispiel in der Wärmeversorgung auf Hackschnitzelheizungen umgerüstet. Das Gipfelholz, also das Gehölz der Baumkronen, kann relativ günstig verwertet werden. Vorwiegend sind hier Fichten, Tannen und Buchen gefragt – also Nadelholz.
„Die Versorgung mit Hackschnitzel wird immer wichtiger“
Sie haben den Vorsitz der Waldbesitzervereinigung (WBV) im Landkreis inne. Was gibt es da zu tun?
Die Aufgaben sind vielfältig. Wir mieten beispielsweise Lagerflächen an und vermarkten das Holz dann zentral. Die WBVs Grafenau und Wolfstein haben vor sieben Jahren wegen personeller Engpässe fusioniert – das hat viele Schultern entlastet und war eine gute Entscheidung. Wir haben nun rund 2.000 Mitglieder und mussten für die Verwaltung eigenes Personal einstellen, da die Arbeit sonst kaum zu stemmen gewesen wäre.

Hinter dem Mattheishof liegt der dazugehörige Wald, um dessen Aufforstung sich die Braumandls ab November kümmern wollen.
Eine unserer Aufgaben ist es das Holz zu bündeln und mit den Sägewerken einen bestmöglichen Preis auszuhandeln. Die einzelnen Vereine haben sich zum Dachverband der forstwirtschaftlichen Vereinigung zusammengeschlossen. Es gehört also nicht nur zu unseren Aufgaben das Holz zu verkaufen, sondern auch beratend zu helfen, da der Staat sich mehr und mehr aus der Beratung zurückzieht. Wir werden zwar vom landwirtschaftlichen Ministerium gefördert, müssen dafür aber vermehrt die fachkundige Beratung übernehmen. Das ist ein massiver Arbeitsaufwand und wir können dafür nichts verlangen.
Welche Themen muss man sich da vorstellen?
Wir beraten die Mitglieder vermehrt in Sachen Nachhaltigkeit. Das heißt: Wir nehmen nur die starken Stämme heraus und sorgen für eine Naturverjüngung. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Hackschnitzelversorgung für die Region. Die macht viel Arbeit und erfordert vor allem fachkundige Organisation. Gott sei Dank gibt es zahlreiche qualifizierte, junge Leute, die im WBV tätig sind, so dass ich sagen kann: Wir sind nicht die Schlechtesten in Niederbayern!
„Landwirtschaft wird immer eine Zukunft haben“
Also blicken Sie zuversichtlich in die Zukunft der Region?
Je kleiner die Strukturen eines Verbandes sind, desto schwieriger ist es. Eine Vereinigung muss eine gewisse Größe haben, um sich Personal leisten zu können. Wir stehen hier mit unserem Verband nicht schlecht da. Alles in allem blicke ich deswegen zuversichtlich in die Zukunft. Das sieht nicht jeder so, aber ich denke, es ist bisher immer weitergegangen.
Die körperliche Arbeit ist nicht mehr so schlimm wie früher – dafür gibt es vermehrt geistige Arbeit zu leisten, zum Beispiel durch die Organisation. Die jungen Leute bekommen daher eine sehr gute Ausbildung. Es werden künftig vielleicht nicht alle Betriebe überleben, aber die Guten ganz gewiss. Landwirtschaft wird immer eine Zukunft haben. Einige werden da zwar nicht meiner Meinung sein, aber ich sehe das so. Die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass es immer weitergeht …
Herr Braumandl, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Interview: Martin Larisch
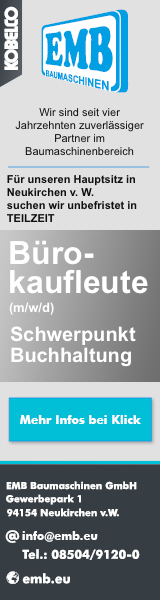














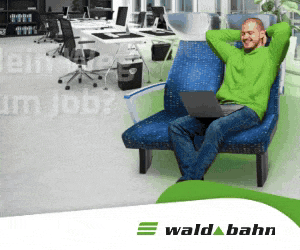






























Servus!
sehr interessanter Artikel! Würde öfter gerne Berichte über die heimische Landwirtschaft lesen.
Leider ist euch ein fachlicher Fehler unterlaufen: „Genfreies Soja“ gibt es nicht. „Gentechnikfrei“ allerdings schon.
Ansonsten: Der Hog’n gfoid ma guad und les i gern.
Vielen Dank für den Hinweis, Sebastian! Wir bessern’s gerne aus.
Dein Hog’n-Team