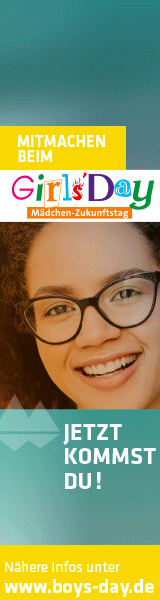Passau. Man kennt sich – und ist seit Langem auch „per Du“. Das Onlinemagazin da Hog’n begleitet Hannes Ringlstetter schon seit einer gefühlten Ewigkeit – und umgekehrt. Erster Berührungspunkt war ein Interview vor zehn Jahren in der Alten Schmiede in Riedlhütte, ehe 2017 ein weiteres Gespräch folgte. 2020 dann der vorläufige Höhepunkt – Stichwort: Dialekt-Fauxpas. Es war und ist immer ein Miteinander auf Augenhöhe, es hat immer gepasst. „Nun sind wir älter geworden – und dicker“, bringt es der 52-Jährige, wie man es von ihm gewohnt ist, auf den Punkt.

Inzwischen Stammgast auf diversen Kabarett- und Musikbühnen sowie im TV: Der Niederbayer Hannes Ringlstetter. Dieses Bild wurde Ende Februar aufgenommen, als der 52-Jährige im Scharfrichterhaus in Passau auftrat.
Treffpunkt dieses Mal: Das Scharfrichterhaus in Passau. Auftritte auf jener bekannten Kleinkunstbühne sind für den Kabarettisten, Komiker, Musiker, Schauspieler, TV-Moderator und Buchautor wie eine Rückkehr nach einer lange Reise ins traute Heim. „Passau ist generell ein gutes Pflaster für mich. Und im Scharfrichterhaus habe ich regelmäßig die Premiere meiner Soloprogramme gefeiert.“
Da Hog’n und Ringlstetter – alte Freunde
Dieses Mal hat er aus seinem Buch „Paris. New York. Alteiselfing“, gewissermaßen eine Art Biographie, vorgelesen. Und auch das neuerliche Hog’n-Gespräch, das im Vorfeld stattgefunden hat, ist zunächst geprägt von einem Rückblick, ehe Ringlstetter sehr persönlich und tiefgründig wird…
Hannes, hast Du einen Lieblingsbegriff im Waidler-Dialekt?
Gschiggd. Eindeutig. Das klingt so schön französisch und ist ein so vielschichtiges Wort. ‚Is do heid gschiggd‘ ist eine Variante. Damit meint man ’schön‘. ‚Hama gschiggd‘ bedeutet soviel wie ‚Hama soweit‘. Dann gibt’s noch die Bedeutung als ‚versiert‘. Eigentlich hat das Wort in jedem Eck Niederbayerns weitere Auslegungen.

Die Premiere: 2013 begegneten sich da Hog’n und Ringlstetter das erste Mal – in der Alten Schmiede in Riedlhütte.
Du weist, worauf wir hinaus wollen?
Ich kann es mir denken, ja.
Vor zwei Jahren hast Du Dich über den Waidler-Dialekt a bisserl lustig gemacht – Stichwort: Martin Moser. Die Folge: ein kleiner Shitstorm. Wie blickst Du heute auf diese Geschichte zurück?
Genauso wie damals. Wenn ich mir in meinem Beruf über alles, was ich mache und lustig finde, ausführlich Gedanken machen würde, wer was darüber denken könnte – dann könnte ich nicht mehr auftreten. Es gibt immer jemanden, der sich über irgendetwas aufregt. (überlegt) Ich stehe eben sehr auf Wort- und Soundspiele. Doa, doa ma do, doa ma do ned. Sowas finde ich lustig. Und ich finde die Geschichte mit bzw. über Martin Moser heute noch lustig.
„Ich habe mich bei Martin Moser entschuldigt“
Und die Reaktionen?
…waren aus meiner Sicht etwas übertrieben. Aber damit muss man leben in Zeiten, in denen über WhatsApp und Facebook Informationen, Videos und Fotos innerhalb weniger Sekunden weitergeleitet werden können. Und ich glaube, das war damals auch so. Bei mir nämlich kamen überhaupt keine kritischen Stimmen an. Ich habe das nur über Dritte erfahren.
Verstehst Du diejenigen, die sich darüber aufgeregt haben?
Ich habe mich dafür bei Martin Moser entschuldigt, sollte ich ihn verletzt haben. Die Sache an sich finde ich – wie schon gesagt – nach wie vor lustig. Mache ich das Gleiche über einen Typen aus dem Allgäu, lacht sich jeder Waidler kaputt. Will heißen: Manchmal ist es ratsam, einen Schritt weiter zu denken. Wenn ich über etwas lachen kann, was einen anderen betrifft, muss ich damit leben, dass gelacht wird, wenn es mich betrifft. Humor ist bekanntlich wichtig. Und trotzdem ist mir etwas bewusst geworden rund um diese Geschichte.
Was denn?
Diese Nummer war der Startschuss dafür, sich noch mehr mit Dialekten zu beschäftigen. Und ich habe gemerkt, wie wichtig den Leuten ihr Dialekt ist. Verunglimpfung ist das eine. Die tiefgehendere Bedeutung des Dialekts das andere. Das ist unsere Identität.
„Das Problem: Es wurde alles schon einmal gemacht“
Wie schwierig ist die Gratwanderung für einen Kabarettisten zwischen „etwas belächeln“ und „ins Lächerliche“ ziehen?
Ins Lächerliche ziehen mache ich nie. Und das ist es, was mich in der Moser-Sache am meisten getroffen hat. Ich finde, man muss über fast alles lachen können. Man darf aber niemanden lächerlich machen. Außer es ist ein sehr mächtiger Mensch, der sich daneben benimmt. Haut ein Aiwanger wieder 14 Sachen raus, bei denen sich fast jeder denkt, wie er das intellektuell wieder hinbekommen hat, darf man ihn ins Lächerliche ziehen. Hebt ein Söder beim Aschermittwoch einen Maßkrug in die Höhe und sagt: ‚Mit der CSU – ohne Drogen!‘ könnte ich mich totlachen. Noch einmal: Man braucht Humor – gerade in der vergangenen Zeit. Humor ist eine Möglichkeit, mit der schrecklichen Welt zurecht zu kommen.

„Wir brauchen Kunst im Allgemeinen und Humor im Besonderen, um zumindest mal für zwei Stunden eine Leichtigkeit zu bekommen.“
Ist es vielleicht sogar die große Kunst, manchmal bewusst die Grenzen zu überschreiten?
Das Problem ist: Es wurde ja alles schon einmal gemacht. Das Rad wurde schon so oft neu erfunden, dass es ein weiteres Mal nicht mehr möglich ist. Die Aufgabe unserer Kunstform ist es ohnehin, die Menschen wieder zu verbinden – und nicht: nochmal spalten, nochmal spalten und nochmal spalten. Keiner, der auf die Bühne geht, weiß, was auf unserer Welt wirklich los ist. Keiner kann sich das alles erklären. In aktuellen Zeiten muss man Zweifel haben, man muss ratlos sein – auch traurig. Der persönliche Ausweg: Selbstironie, Humor.
„Ich habe keine Lust auf Provokation“
Du bist als Kabarett auch Psychologe?
Ja. Das war aber schon immer so. Nur früher hat man das nicht so benannt. Jetzt kann man das durchaus machen. Wir brauchen Kunst im Allgemeinen und Humor im Besonderen, um zumindest mal für zwei Stunden eine Leichtigkeit zu bekommen. Nur so verkraftet man den Wahnsinn dann wieder.
Sind solche Aufreger wie die Martin-Moser-Geschichte bewusst gesteuert, um aufzufallen im Pool der immer größer werdenden Masse an Kabarettisten, Komiker etc.?
Nein. Null. Es ist auch selten, dass eine Geschichte derartige Wellen schlägt wie damals. Ich habe generell keine Lust auf Provokation.
Mit den unterschiedlichen Ausdrücken des bairischen Dialektes beschäftigt sich Ringlstetter gerne
Provokation gehört aber als Kabarettist dazu, oder nicht?
Und mit was provoziere ich dann? Mit Dingen, mit denen ohnehin schon unzählige Male provoziert worden ist. Dass ich von gendern nichts halte? Das interessiert doch sowieso niemanden mehr.
Wie schwierig ist es angesichts dessen, immer wieder etwas Neues, ein neues Programm, zu kreieren?
Gar nicht. Mein Geheimrezept: die vielen Wechsel. Band, Soloprogramme, Fernsehen, Schauspielerei. Ich hätte es als Solo-Kabarettist wahrscheinlich einfacher gehabt. Aber irgendwann wäre es zu viel geworden – für mich und natürlich auch für die Zuschauer bzw. Zuhörer. Ich habe immer selber dafür gesorgt, dass ich künstlerisch wach bleibe.
„Nicht dem Geld folgen, sondern dem eigenen Antrieb“
Gelernt habe ich auch, dass man nicht dem Geld oder Erfolg folgen darf, sondern dem eigenen Antrieb. In manchen Phasen will ich mich zurückziehen und Lieder schreiben. Dann will ich aber auch ab und an auf Tour gehen und was erleben. All das führt dazu, dass ich eigentlich noch nie Probleme damit hatte, neue Lieder oder Programme zu machen.
Bist Du Künstler oder Handwerker?
Ohne Handwerk gibt es keine Kunst.

„Die Zeit hat mich gelehrt, dass ich nicht mehr den Zwang habe, zu allem meine Meinung zu sagen. Aber wenn ich’s dann doch tue, stehe ich auch zu dem, was ich sage.“
Ist – so paradox es klingen mag – die immer verrückter werdende Welt ein großer Vorteil für Dich?
Ich bin ja selber Teil dieser verrückter werdenden Welt. Und auch ich selber muss darauf achten, eine gewisse Leichtigkeit zu bewahren. Es besteht die Gefahr, dass ich mein eigenes Programm so dermaßen überziehe, dass ich dadurch eingeschränkt bin im Denken und Handeln. Das ist das eine. Das andere: In so schwierigen Zeiten suchen die Menschen Sprachrohe, die das in Form bringen, was sie als diffuses Gefühl wahrnehmen. Und da muss man aufpassen. Denn so entstehen bekanntlich Diktaturen. (überlegt) Kunst hat die große Chance, verbindend zu sein. Und gerade jetzt muss sie das auch machen.
Hast Du schon immer so weit gedacht?
Nein.
Würdest Du Dir heute mehr trauen als vor 20 Jahren?
Ja.
„Muss nichts mehr, kann nur noch“
Inwiefern?
Ich habe mehr Haltung. Die Zeit hat mich gelehrt, dass ich nicht mehr den Zwang habe, zu allem meine Meinung zu sagen. Aber wenn ich’s dann doch tue, stehe ich auch zu dem, was ich sage. Das hätte ich mir früher nicht so getraut.
Um Deine Karriere nicht zu gefährden?
Vielleicht. Das kann durchaus eine Rolle spielen. Ich hab’s nicht in mir gehabt, für solche Knalleffekte zu sorgen. Meine Entwicklung ging eher sachter.
Was kommt noch?
So denke ich nicht. Natürlich will man immer besser oder präziser werden. Erfolgstechnisch erlebe ich viel mehr als ich mir jemals gedacht hätte. Auch deshalb gibt es keine großen konkrete Ziele mehr. Ich bin in der luxuriösen Rolle, nicht mehr zu müssen, sondern nur noch zu können.
Schöner Abschluss. Danke für das Gespräch – und bis demnächst wieder mal.
Interview: Helmut Weigerstorfer