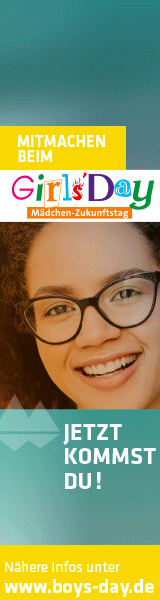Ulaanbaatar. Eine Landschaft, die das Wort „weitläufig“ wohl mehr als verdient hat. Zwischen Russland und China ist sie zu finden. Und wer sie besuch hat, kommt wohl so schnell nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. So wie Merlin Löwecke, den es vor fünf Jahren in die nördliche Mongolei verschlagen hatte, um den Tsaatan-Nomaden und deren Rentiere einen Besuch abzustatten. Dem Onlinemagazin da Hog’n berichtet der Weltenbummler aus Pfarrkirchen im Rottal von seinem schmerzhaft-schönen Abenteuer…

Nicht gesucht, aber gefunden: Merlin Löwecke und Reisekumpan Lucien aus Frankreich ziehen gemeinsam los durch die nord-mongolische Weite. Ihr Ziel: Der Besuch einer Rentierfamilie. Fotos: Merlin Löwecke
Nach meiner Landung in Ulaanbaatar und einigen Tagen Aufenthalt im Gorchi-Tereldsch-Nationalpark bin ich zur „Travel-Mongolia“-Tourist-Information gegangen. Dort habe ich sogleich meine erste Mongolei-Tour gebucht – und auch ein kostenloses Hostel vermittelt bekommen. In meiner Unterkunft treffe ich auf Lucien, einen munteren Franzosen mit klassischem Schnurrbart. Mein erster Gedanke: Klemm ihm ein Baguette unter den Arm – und er schaut aus wie der Typ aus dem französischen Klischee-Bilderbuch. Wir unterhalten uns gut und tauschen uns über unsere Pläne aus. Dabei stellt sich heraus, dass er – genau wie ich – Lust auf viel Natur und Wandern hat. Er will in den Norden durch die Berge streifen – und dann bei einer Rentierfamilie leben. Klingt interessant. Ich bin dabei – wann geht’s los? Morgen? Perfekt!
Bären? Wölfe? Ach was…!
Schnell noch ein Busticket gebucht, essen eingekauft – und ab geht’s. Zwölf Stunden in einem Nachtbus über holprige Straßen in Richtung Norden. Endstation ist Mörön, die Hauptstadt der Chöwsgöl-Region. Dort werden wir von einer fließend Englisch sprechenden Mongolin abgefangen und zu einem Hostel gekarrt. Wir versuchen Informationen zu bekommen, die für die Umsetzung unserer Pläne hilfreich sind. Leider gibt es kein detailliertes Kartenmaterial – und jeder teilt uns mit, dass zu dieser Jahreszeit ein derartiges Unterfangen nicht möglich sei. Es ist zu kalt – und in den Bergen gibt es doch Wölfe und Bären! Lucien und mir ist das egal… Also das nächste Busticket und eine Aufenthaltsgenehmigung für die Grenzregion organisiert – und los geht’s nach Khatgal. Von hier aus werden wir loswandern.
Immer noch auf der Suche nach Infos treffen wir endlich auf einen Mann, der die Reise für hart, aber möglich hält. Seine Frau allerdings meint, dass letztes Jahr eine Frau in den Bergen gestorben sei zu dieser Jahreszeit. Woran genau, das kann sie uns nicht erklären – nur, dass sie alleine war. Wer reist denn schon alleine…?
Unser erstes Ziel, das wir ansteuern wollen, ist Renchinlkhümbe. Die Stadt liegt auf der anderen Seite der Berge, ca. 120 Kilometer von unserem momentanen Aufenthaltsort entfernt. Fünf Tage Fußmarsch planen wir ein – und besorgen dementsprechend viel zu essen. In der Nacht testen wir Luciens Zelt. Es hat null Grad – ganz schön kalt, aber lässt sich schon aushalten…
Vodka, Schach, Max Fun & Micropur
Nächster Tag. Zelt abgebaut und wir marschieren los. Der Rucksack wiegt gefühlte zehn Tonnen. Bald lassen wir die „Stadt“ hinter uns. Die Natur am Chöwsgöl Nuur, der immer noch gefroren ist, ist wunderschön. Den ganzen Tag wandern wir am See entlang. Abends suchen wir uns eine windgeschützte Stelle, machen Feuer, bereiten unser Essen zu und kochen das Wasser ab, was man hier vor dem Trinken machen sollte. Es dauert ewig, die vier Liter Wasser zu entkeimen. Wir beschäftigen uns mit Vodka und Schach. Spät fallen wir erschöpft ins Zelt. Wir haben an diesem Tag rund 25 Kilometer zurückgelegt. Beine und Schultern tun weh. Wie wird’s wohl morgen werden?
Nach einer weiteren kalten Nacht geht’s weiter. Die Schmerzen sind überwiegend weg. Wir legen in etwa die gleiche Strecke zurück – und abends heißt es dann wieder Wasser und Essen kochen, gepaart mit Vodka und Schach. Wir schauen Leuten beim Eisfischen zu. Ich bin erstaunt, dass sie die kleinen Fische behalten – und die großen zurück in den See werfen. Heute gehen wir früher schlafen – und stehen dementsprechend eher auf, um los zu starten. Unser Tagesziel lautet Jigleg, ein Jurtencamp, das wir – wie die meisten anderen Camps – verlassen vorfinden.
Wir erreichen Jigleg am frühen Nachmittag, nach einem 20-Kilometer-Fußmarsch. Nach zwei Stunden Mittagsschlaf beschließen wir den Bergpass noch zu überqueren und machen uns auf den Weg. Bergauf laufen zieht sich ewig – und ich bin hart am Limit. Zum Glück haben wir aber „Max Fun“ dabei, die Schokolade für alle Fälle. Sie gibt uns soviel Energie, dass wir den Pass schaffen und noch ein paar Kilometer mehr zurücklegen. Zum Feuer machen sind wir an dem Tag zu müde. Zum Glück hab ich „Micropur“-Tabletten zum Wasser aufbereiten dabei. Die Nacht ist elendig kalt. Es hat zwischen minus 5 und minus 10 Grad. Am nächsten Morgen ist alles gefroren – inklusive unsereins. Und ich mache erst einmal Feuer, um uns aufzutauen.
Wie die Zombies
Wir marschieren bald los, um uns warm zu halten. Da wir am Tag zuvor 32 Kilometer zurück gelegt haben, beschließen wir dies nun zu toppen – und Renchinlkhümbe zu erreichen. Ist ja „nur“ 40 Kilometer entfernt – und es geht hauptsächlich bergab. Doch der Weg ist schwieriger als gedacht. Oft müssen wir einen halb zugefrorenen Fluss überqueren. Das Eis wird zum Erlebnis. Häufig brechen wir ein oder müssen die Schuhe ausziehen, um voran zu kommen. Zum Glück ist das Wasser nicht tief.
Wir marschieren den ganzen Tag über – ohne lange Pausen – dahin. Renchinlkhümbe liegt in einer großen Ebene. Noch fünf Kilometer. Die Stadt ist in Sichtweite, aber die letzten Meter fühlen sich unendlich lang an. Kurz vor dem Zielort überrascht uns dann noch ein Hagelsturm. Wir sind am Ende unsere Kräfte, können kaum noch laufen und marschieren wie Zombies durch den Ort – auf der Suche nach einem Supermarkt und einer Unterkunft. Wir sind überglücklich als wir einen „Supermarkt“ finden – und belohnen uns mit Zigaretten, Bier und Schokolade. Auch das „Hotel“ ist nicht weit und es gibt sogar eine heiße Dusche. Wir sind im siebten Himmel.
Nachdem wir uns ausgeruht haben, beschließen wir gegen Mittag am nächsten Tag weiter zu marschieren. Unser Ziel, Tsagaaannuur, liegt 43 Kilometer weit entfernt, also zwei entspannte Tage Fußmarsch. Wir durchqueren die Ebene, der Blick geht ewig weit – und es gibt nichts, was den Wind bremst, der uns entgegen bläst. Wir frieren und fühlen uns als würden wir kaum voran kommen.
Strapazen fürs Hinterteil
Nach 23 Kilometern erreichen wir einen Fluss, den wir mit einer Fähre, ein riesiges Floß, das noch per Hand am Stahlseil über das Wasser gezogen wird, passieren müssen. Am anderen Ufer angelangt überlegen wir, ob wir noch weiter wandern wollen. Wir entscheiden uns dagegen – und dafür, den Fährmann um einen warmen Platz am Feuer zu bitten. Wir kochen mit ihm, teilen was wir haben und kommen, soweit das möglich ist, ins Gespräch. Der Fährmann spricht nur mongolisch. Wir verbringen eine gute Zeit, essen, trinken Tee mit mal mehr und mal weniger Leuten in der winzigen Hütte – und natürlich darf der Vodka nicht fehlen. Am Ende sind wir ziemlich besoffen – und fallen ins Bett…

Die Tsaatan-Nomaden leben mit den Rentieren, deren Instinkt bestimmt, wo genau die Familien ihre Zelte aufschlagen.
Tags darauf wird gemeinsam gefrühstückt und nachdem wir uns verabschiedet haben, legen wir die letzten 20 Kilometer zurück. Völlig am Ende unserer Kräfte kommen wir in Tsagaaannuur an. Zwar sind wir nicht recht weit gelaufen, aber unser Marsch hat Folgen: Wir haben etliche Blasen an unseren Füßen, die wir zunächst einmal verarzten. Anschließend geht’s zum Essen – welch ein Luxus! Dann planen wir unsere Weiterreise. Unseren Füßen zuliebe und um Zeit zu sparen, mieten wir Pferde, die uns zum Tsaatan-Camp, wo die mongolischen Rentiernomaden leben, bringen sollen. Wir sitzen am nächsten Tag ganze acht Stunden im Sattel. Meinen Füßen geht es gut. Für meinen knochigen Hintern ist der Ritt jedoch die reinste Qual. Aber wir sind endlich am Ziel angekommen.
Wir verbringen die nächsten Tage in einem Tipi in den Bergen der Taiga, mitten im Nirgendwo. Die Leute dort leben zwar abseits, aber nicht unbedingt rückständig. Sie besitzen ein Telefon und sogar einen Fernseher. Strom beziehen sie aus Autobatterien, die sie tagsüber mit Solarpanelen aufladen. Die Bewohner halten sich Rentiere als Nutztiere. Lustige Viecher, die komische Grunzlaute von sich geben. Wir essen deren Fleisch und trinken deren Milch. Ansonsten wandern wir viel herum und spielen viel Schach. Und dann geht es wieder zurück. Erneut acht Stunden reiten. Wie ich mich freue! Mein Hintern hat den letzten Ausflug immer noch nicht richtig verdaut…
Und noch ein Abenteuer…
Am Morgen darauf erwartet uns schon das nächste Abenteuer. Wir fahren mit dem Bus zurück nach Mörön. Mehr als 200 Kilometer über holprige Straßen, wenn man die unasphaltierten Buckelpisten denn als solche bezeichnen kann. Bei der Hälfte der Strecke bricht meine Rückenlehne weg. Mal bleiben wir im Schlamm stecken, aus dem wir den alten, russischen Van per Hand wieder herausziehen müssen. Dann macht der Motor Probleme. Alle paar Kilometer gibt die Benzinpumpe den Geist auf – und der Fahrer und sein Mitfahrer fangen wie wild an am Motor herum zu schrauben. Wir benötigen 14 Stunden für die Strecke. Meine Poknochen sind halb durchgescheuert.
Am nächsten Tag wieder zwölf Stunden Autofahrt. Zwar geht es nun mit einem Geländewagen auf geteerten Wegen dahin, doch nach den Strapazen der vergangenen Tage macht es keinen Unterschied mehr, worauf ich sitze. Es ist eine Qual. Ich bin unendlich froh, als ich wieder in Ulaanbaatar ankomme und mich frei bewegen kann. Ja, das Reisen durch die Mongolei ist abenteuerlich und – mal von etwaigen Sitzproblemen abgesehen – wunderschön. Eine wilde Zeit, die ich gewiss nie vergessen und für immer in meinem Herzen behalten werde.
Merlin Löwecke