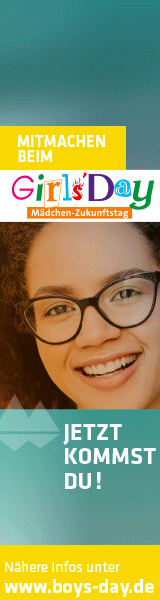München. Zu viele Fragen sind noch unbeantwortet. Die Angehörigen der Opfer sehnen sich nach weiterer Aufklärung. Es geht darum, noch mehr Licht ins immer noch relativ große Dunkel zu bringen, das der NSU-Komplex hinterlassen hat. Der NSU-Prozess, der 2018 mit der Urteilsverkündung gegen die Hauptangeklagte Beate Zschäpe endete, konnte zwar weitere Details hinsichtlich der von der rechtsextremen Terrorgruppe begangenen Mordserie offenbaren. Doch aufgearbeitet scheint jenes abscheuliche Konglomerat aus Tötungsdelikten, Sprengstoffanschlägen, Raubüberfällen und Mordversuchen noch lange nicht.

Grünen-MdL Toni Schuberl (rechts), Vorsitzender des zweiten Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags (kurz: NSU II), mit seinem Stellvertreter Josef Schmid (CSU). Fotos: Stefan Obermeier/ Bildarchiv Bayerischer Landtag
Seinen Teil zur Aufklärung beitragen will der in Zenting im Landkreis Freyung-Grafenau wohnhafte Grünen-Politiker Toni Schuberl. Er wurde zum Vorsitzenden des zweiten NSU-Ausschusses im Bayerischen Landtag ernannt. Als Jurist und rechtspolitischer Sprecher seiner Partei leitet er seit der konstituierenden Sitzung im Mai dieses Jahres das Gremium, das bis dato achtmal zusammenkam. Bis zu elf weitere Sitzungen sind in diesem Jahr noch geplant. Doch die Zeit drängt bereits, wie er dem Onlinemagazin da Hog’n gegenüber im Interview betont.
Herr Schuberl: Warum gibt es den NSU-Ausschuss II überhaupt? Warum wurde er ins Leben gerufen?
Der erste bayerische Untersuchungsausschuss fand bereits sehr früh statt und endete Mitte des Jahres 2013. Da war vieles noch nicht bekannt. Zudem waren manche Akten noch nicht beziehbar, weil die Ermittlungen noch angedauert haben. Nun sind die U-Ausschüsse im Bund und in den Ländern weitestgehend beendet. Der NSU-Prozess ist vorbei, die Verurteilung ist rechtskräftig. Das heißt: Die Akten sind für uns nun grundsätzlich einsehbar.
Das Beantworten noch offener Fragen
Der wichtigste Grund lautet: Es sind Fragen bis heute offen geblieben. Fragen, bei denen es in den Untersuchungsausschüssen geheißen hatte, dass diese der Prozess klären müsse. Und im Prozess hieß es, dies Fragen seien in den Untersuchungsausschüssen zu klären. Wir, die Verantwortlichen des NSU II in Bayern, haben uns vorgenommen, nun eben jene Fragen, die noch offen sind, zu beantworten – sofern dies überhaupt möglich ist.
Ist der NSU II dann als eine Art Kritik an den vorausgegangenen Ausschüssen zu sehen?
Nein, das kann man so nicht sagen. Der erste hatte sehr wenig Zeit, noch weniger als wir. Er konnte es nicht besser machen, weil noch sehr wenig bekannt war. Die weiteren Ausschüsse anderer Länder und des Bundes – insgesamt gab es in Deutschland bis dato ja 13 – hatten natürlich keinen Fokus auf Bayern. Am Prozess selbst könnte man die Kritik üben, dass sehr viele Fragen nicht gestellt und sehr viele Zeugen, die interessant gewesen wären, nicht vernommen worden sind.
Doch es gibt die Konzentrationsmaxime und den Beschleunigungsgrundsatz, sprich: sich nur auf dasjenige zu konzentrieren, was zur Verurteilung derjenigen führt, die Angeklagt sind. Alles drumherum interessiert in einem Strafprozess nicht. Daher ist so vieles offen geblieben – und deswegen waren die vielen Angehörigen enttäuscht. Das ist nun die Aufgabe eines U-Ausschusses: Wir prüfen nicht nur das, was zu einer Verurteilung führen würde. Wir sind kein Gericht, aber wir verfügen über gewisse richterliche Werkzeuge wie Zeugenvernehmungen, Akteneinsichtsrechte etc. Wir werden sicherlich nicht alle offenen Fragen beantworten können, aber wir werden es versuchen.
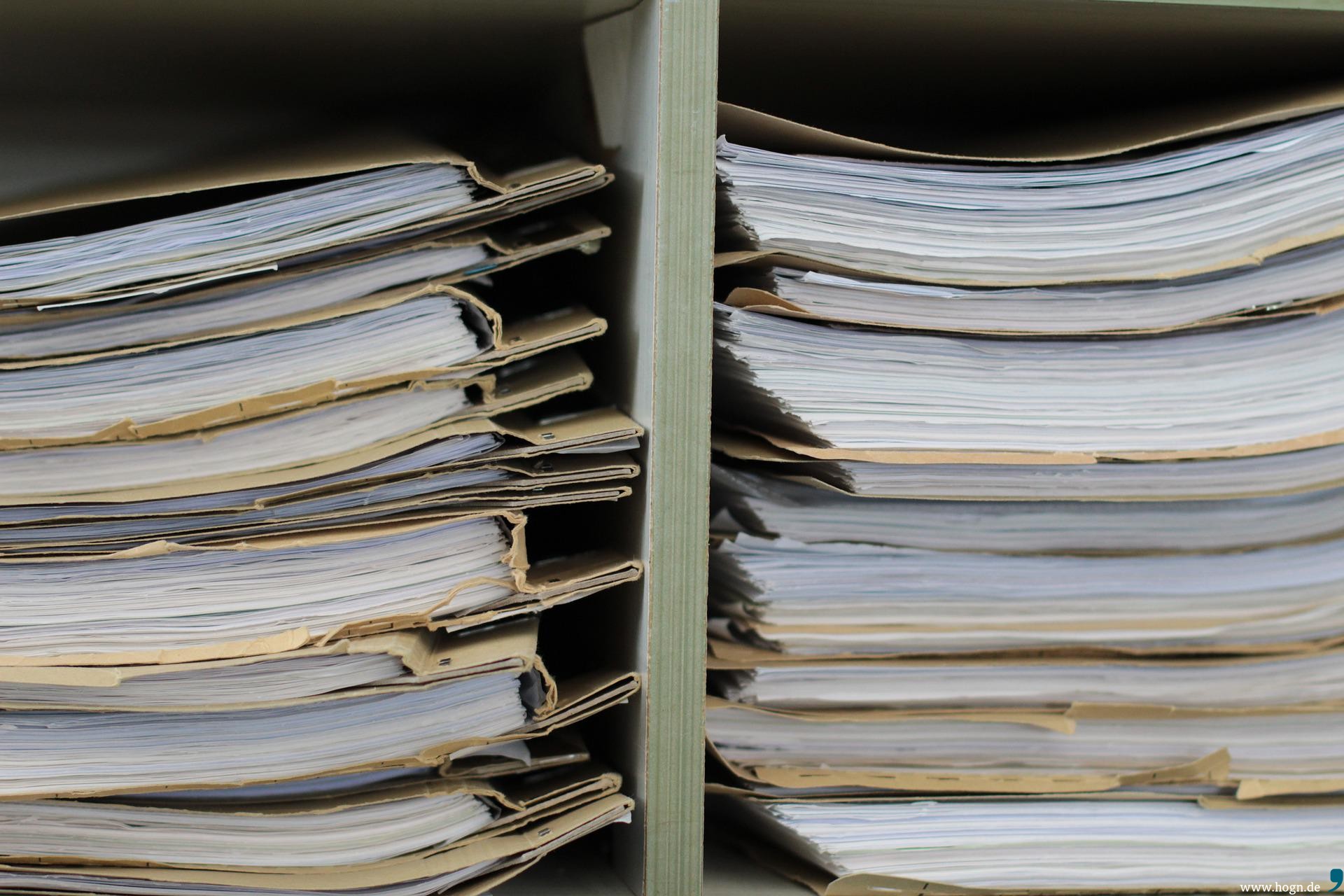
„Wir können die Akten zumindest sichten und uns auf die dringendsten Themen konzentrieren.“ Symbolfoto: pixabay/ bboellinger
Wie groß ist der Aktenberg, den es zu wälzen gilt?
Es geht um tausende Akten, bei denen es nicht möglich sein wird sie im Detail durchzuarbeiten. Das geht in der relativ kurzen Zeit und mit dem vorhandenen Personal nicht. Aber wir können die Akten zumindest sichten und uns auf die dringendsten Themen konzentrieren. Generell gilt: Den NSU-Komplex aufzuklären ist eine riesige Mammutaufgabe, die noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird – und auch nicht aufhören darf. Wenn die Sache nun auch juristisch abgeschlossen ist – und wenn sie demnächst dann auch parlamentarisch größtenteils abgeschlossen sein wird. Vermutlich wird unser Untersuchungsausschuss einer der letzten sein. Doch man muss dennoch künftig weiter aufklären.
„Skandalös und nicht nachvollziehbar“
Was gehört denn etwa zu den dringendsten Fragen?
Einen Komplex für sich bildet etwa der Taschenlampen-Anschlag von Nürnberg im Jahr 1999. Dieser Anschlag ist zunächst nicht dem NSU zugerechnet worden. Damals wusste noch niemand etwas vom NSU. Erst später, im Prozess, hatte dann einer ausgesagt, was dazu führte, diesen Anschlag dem NSU zuzuschreiben. Dies war somit der erste Anschlag, zu dem bis dato weder in einem U-Ausschuss ermittelt worden ist, noch haben die Strafverfolgungsbehörden sowohl vor als auch nach Enttarnung des NSU dazu richtig nachgeforscht, noch ist es im Prozess groß behandelt worden. Es gibt hier noch widersprüchliche Aussagen, die geklärt werden müssen. Das ist eines dieser Puzzle-Teile, die von unserer Seite soweit wie möglich ermittelt werden wollen. Und wir, die Ausschussmitglieder, sind die einzige Distanz, die verblieben ist, dies anzupacken. Die juristische Aufarbeitung hierzu ist wohl bereits abgeschlossen – leider.
Was zudem für uns als Landtag und Kontrollelement der Regierung sowie der polizeilichen Staatsgewalt ein Thema ist: Dieser Mordanschlag von Nürnberg wurde als fahrlässige Körperverletzung eingestuft. Das ist skandalös und alles andere als nachvollziehbar – und hat dazu geführt, dass die Asservate nach der Einstellung nicht aufbewahrt bzw. nicht pfleglich behandelt worden sind. Die als Taschenlampe getarnte Rohrbombe wurde zum Schulungsobjekt umfunktioniert – damit war sie wertlos. Feststeht: Es war der erste Anschlag des NSU- und bis fast zum Schluss hatte sich die Polizei geweigert, hier einen rechtsextremen Hintergrund anzunehmen.
Welches Thema ist noch von Belang?

„Wir haben uns die Tatorte in München und Nürnberg vor Ort angeschaut.“ Symbolfoto: pixabay/ 12019
Es gibt die Streitfrage, ob der NSU ein für sich allein stehendes Trio aus Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe war – sprich: ohne Helfer agierte. Oder ob es sich dabei um ein Netzwerk handelte. Wir sind der Meinung: letzteres. Der Generalbundesanwalt hingegen meint, es sei ein in sich geschlossenes Trio gewesen.
Es gibt Leute, die zwar als Unterstützer des Trios mitverurteilt worden sind, jedoch nicht für die Taten an sich. Wir sind aber der Meinung, dass das Ausspähen der Tatorte, die Erstellung der sog. 10.000er-Liste mit möglichen Tatorten etc. nicht allein von dem Trio selbst gemacht wurde. Daher haben wir Ausschussmitglieder uns die Tatorte in München und Nürnberg vor Ort angeschaut. Aus meiner Sicht war es dabei ziemlich eindeutig, dass diese Tatorte niemand von Zwickau aus observiert hat. Da muss man schon länger vor Ort sein – und sich auskennen. Und: Diejenigen sind vielleicht immer noch da. Das ist das Erschreckende – vor allem für die Angehörigen. Das sind die, die womöglich den Ehemann, Vater, Sohn als Opfer ausgewählt haben – und vielleicht immer noch in der Nachbarschaft wohnen.
Wird auch Beate Zschäpe vorgeladen?
Wie wird man eigentlich Vorsitzender von so einem Ausschuss?
Die Grünen bilden die zweitstärkste Fraktion im Landtag, daher bekommen wir den Vorsitz. Ich bin Volljurist, die eigene Profession spielt eine Rolle: Man soll die Befähigung zum Richteramt haben, weil man die Funktion eines Richters hat. Ich belehre Zeugen, ich lade vor, wir haben Zwangsmittel, können auch jemanden einsperren, wenn er nicht aussagt. Wir agieren quasi nach der Strafprozessordnung. Das Aufdecken rechtsextremer Strukturen war zudem immer schon mein Anliegen. Und als Historiker bin ich es gewohnt Akten zu studieren und Quellen ausfindig zu machen. Für mich als Politiker, Historiker und Juristen ist das Amt des Vorsitzenden somit genau passend.
Welchen Unterschied gibt es zwischen einem Gerichtsverfahren und einem Ausschussverfahren?
Wir klären auf – das will auch ein Gericht. Wir haben all diejenigen Möglichkeiten, die auch ein Richter hat. Doch es gibt keine Staatsanwaltschaft, keine Verteidigung, keine Angeklagten. Der Ausschuss ist ja immer einem Ermittlungsverfahren nachgelagert. Die Polizei hatte ermittelt – und wir schauen uns das nochmal genauer an und sagen, falls nötig: Moment, hier sind Fehler passiert. Oder: Hier ist noch etwas offen.
Haben die geladenen Zeugen denn ein Zeugnisverweigerungsrecht?

„Wir werden jede und jeden laden, der bzw. die uns bei der Beantwortung unserer Fragen helfen kann.“
So wie vor Gericht auch. Im Grundsatz aber nicht. Nur wenn sie sich selbst belasten würden. Beate Zschäpe hätte zum Beispiel kein Zeugnis-Verweigerungsrecht, weil sie bereits zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. Sie kann nicht mehr stärker verurteilt werden. Wenn sie nicht aussagen möchte, können wir ein Zwangsgeld verhängen – das wird sie aber nicht besonders tangieren. Im äußersten Fall können wir eine Beugehaft anordnen, was sie ebenfalls nicht jucken dürfte – sie ist ja schon lebenslänglich verurteilt. Das heißt: Wir haben Möglichkeiten, aber diese sind faktisch begrenzt.
Wird Frau Zschäpe denn vorgeladen?
Es gibt eine Liste von Zeuginnen und Zeugen, die wir vorladen wollen. Diese ist noch dynamisch und nicht mit den Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss besprochen, daher will ich dazu vorab nicht zu viel sagen. Doch: Wir werden jede und jeden laden, der bzw. die uns bei der Beantwortung unserer Fragen helfen kann.
Gratwanderung mit AfD-Ausschuss-Mitglied
Elf Mitglieder aus verschiedenen Parteien sitzen im NSU-Ausschuss.
Richtig. Alle Parteien sind vertreten, je nach Stärke. Die CSU hat dabei gemeinsam mit den Freien Wählern – analog zum Landtagsplenum – die Mehrheit, dann kommen die Grünen und so fort. Wir alle gemeinsam bilden sozusagen das Gericht. Wir beschließen alle Entscheidungen mit einer Mehrheit der Stimmen. Eine Ausnahme gibt es: Beweisanträge, die von einem Minderheitenquorum – es reichen hier etwa Grüne und SPD – gestellt werden, dürfen nicht abgelehnt werden, es sei denn sie sind rechtswidrig. Dann muss die Mehrheit dem zustimmen.
Wir hatten ja schon mehrere Streitfälle: Es gab vier Beweisanträge, die meiner Meinung nach zulässig wären, aber dennoch von der Mehrheit abgelehnt worden sind. Einige davon wurden im Plenum behandelt, die nächsten werden auch ins Plenum kommen – und dann stellt sich die Frage, ob wir vor den Verfassungsgerichtshof ziehen, um diese Anträge durchzusetzen oder nicht (siehe dazu SZ vom 15. Juli 2022).
Auch ein Kollege von der AfD sitzt als Mitglied im Ausschuss. Wie klappt hier die Zusammenarbeit? Ist man sich grün?
Ich hoffe, dass sich keine der demokratischen Parteien mit der AfD grün ist. Das ist nicht nur das Privileg der Grünen. Der AfD-Politiker sitzt im Gremium, weil er das Recht dazu hat. Und ich als Vorsitzender werde ihn objektiv behandeln. Doch zugegeben: Es ist eine heikle Sache. Wir wollen, dass die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird, was ja zu Teilen bereits der Fall ist. Andererseits bekommen wir Zugang zu geheimsten Akten des Verfassungsschutzes – genauso auch der Herr von der AfD. Das ist eine Gratwanderung – aber wir können nicht jegliche Aufklärung einstellen, nur weil die AfD im Landtag sitzt.

„Es gab die Kritik, dass bestimmte Zeugen nicht vernommen worden sind. Die wollen wir nun vernehmen – einfach, um es versucht zu haben.“
Kann man nach den bisherigen Sitzungen ein erstes Zwischenfazit ziehen?
Ein Fazit lautet, dass die bis dato eigentlich sehr konstruktive Zusammenarbeit zwischen Regierung und Opposition bereits einen Knacks bekommen hat. Grund dafür ist ein Geschäftsordnungsantrag, mit dem man uns demonstrieren wollte, wer die Mehrheit im Plenum innehat. Die Tagesordnung wurde daraufhin umgeschmissen, während wir bereits einen Zeugen zur Vernehmung da hatten. Unsere Beweisanträge wurden gestoppt. Kurz: Die Regierung hatte die Muskeln spielen lassen. Und wir hatten dagegen gehalten. Das hat so einiges kaputt gemacht. Jetzt sind wir aber dabei dies zu reparieren.
Man kann mit einer Mehrheit den Ausschuss lahmlegen, weil wir ja auch eine gewisse Zeitnot haben. Sobald der neue Landtag konstituiert ist, sind wir aus dem Spiel. Dann ist’s vorbei mit dem NSU-Ausschuss. Das heißt: Wir können nur gemeinsam vorankommen – das ist so. Ich hoffe, dass das auch klappt. Es ist eine Frage des politischen Könnens, ob wir das gemeinsam hinbekommen oder nicht.
Rechtsextreme Netzwerke
Stichwort: Rechte Organisationen. Kann sich der Ausschuss nun jegliche bayerische Vertreter davon genauer anschauen?
Leider nicht. Aber diejenigen, bei denen bestimmte Bezüge zum NSU nachgewiesen sind, wie z.B. die rechtsextremen Netzwerke Blood and Honour, Hammerskins, Combat 18 usw. Die sind zwar schon verboten, doch die Leute dahinter gibt es immer noch. Wir wollen wissen, welche Rolle diese Netzwerke im Rahmen des NSU gespielt haben. Wer hat geholfen, wer hat Unterschlupf geboten, wer hat Waffen geliefert, wer hat ausgespäht?

„Auffangbecken derjenigen Leute, die in den verbotenen Organisationen nicht mehr weiterarbeiten konnten.“
Stichwort: Leaderless Resistance. Das heißt: Es gibt rechtsterroristische Zellen, von denen jede für sich agiert und denen die Rechtsextremen im Umfeld helfen sollen, wenn man mit ihrer Ausrichtung und ihren Zielen konform geht. Dennoch sollte man nicht zu viel voneinander wissen. Unsere Aufgabe ist es nun nachzuweisen, dass es ein rechtsextremes Netzwerk gegeben hat, das mit dem NSU kooperiert hat. Das ist nicht einfach. Aber es ist relativ sicher, dass das NSU-Trio Unterstützung hatte. Ich hoffe, wir können etwas herausfinden.
Wie sehen Sie die Rolle des „Dritten Wegs“ in diesem Konstrukt?
Der Dritte Weg ist noch relativ jung. Aus unserer Sicht ist er eines der Auffangbecken derjenigen Leute, die in den verbotenen Organisationen nicht mehr weiterarbeiten konnten. Ein Sachverständiger hat im Untersuchungsausschuss bereits mitgeteilt: Am häufigsten seien Leute mit Beziehungen zum NSU beim Dritten Weg untergekommen. Der Dritte Weg ist nur deshalb eine Partei, weil man ihn dann schwerer verbieten kann. Letztlich ist er die Fortführung bestimmter verbotener Organisationen.
„Vollenden ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“
Abschließend: Wie wahrscheinlich ist es, dass der zweite bayerische NSU-Ausschuss mehr Licht ins Dunkel bringen kann? Sprich: Wie hoch sind die Erfolgsaussichten, dass man etwas bewirken kann?

„Wir tragen ein Puzzle-Stück bei, sodass man ein bisschen mehr erkennen kann vom gesamten Puzzle-Bild.“ Symbolfoto: pixabay/ congerdesign
Das hängt davon ab, was man als Erfolg definiert. Wenn man sagt, wir sollen die noch offenen Fragen restlos aufklären, werden wir scheitern. Wenn man sagt, unsere Arbeit war erfolgreich, wenn wir nur ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können, dann sind wir auf jeden Fall erfolgreich. Wir werden uns aber irgendwo dazwischen bewegen. Wir tragen ein Puzzle-Stück bei, sodass man ein bisschen mehr erkennen kann vom gesamten Puzzle-Bild. Doch das Vollenden des Puzzles ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es ist ein riesiger Komplex, der wohl nie vollständig aufzuklären sein wird.
Mein Job als Vorsitzender ist es, den Abschlussbericht zu schreiben. Dieser umfasst schon jetzt gut einhundert Seiten und wird gewiss noch anwachsen. Am Ende wird er im Parlament präsentiert – und der Landtag beschließt darüber. Was da genau drinsteht und wie formuliert, muss vorab natürlich mehrheitlich ausgehandelt werden.
Vielen Dank für diesen interessanten Einblick – und weiterhin alles Gute.
Interview: Stephan Hörhammer