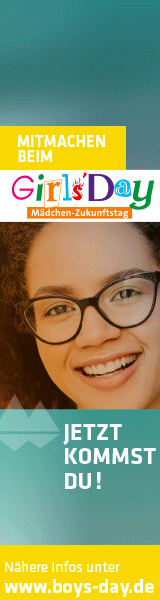Kurt Seul besuchte das Grab von Josef Althammer in der Ukraine – und legte zum Gedenken Blumen nieder. Foto Seul
Grainet/Passau/Kiew. Vielen ehemaligen Schülern des Gymnasiums Freyung ist Kurt Seul als Englisch- und Geschichtslehrer bekannt, war er doch jahrelang als Lehrer dort tätig. Auch die Hog’n-Redakteure Stephan Hörhammer und Helmut Weigerstorfer gehörten einst zu „seinen“ Schützlingen. Nach vielen Jahren, in denen man zwar ungefähr wusste, was der andere macht – der 77-Jährige ist längst pensioniert und lebt in Passau -, wurde der Kontakt durch die Recherchen Seuls über den Graineter Josef Althammer, der im Zweiten Weltkrieg sein Leben ließ, wieder intensiviert.
Menschenmassen ohne Ende
Und so schickte der ehemalige Lehrer seinen ehemaligen Schülern nicht nur einen Bericht über den gefallenen Soldaten, der zur Familie seiner Frau gehörte, zu. Die Hog’n-Redaktion wurde auch über seine Suche nach dem Grab des gefallenen Fürholzers informiert. Kurt Seul nahm dazu die beschwerliche Reise in die Ukraine, wo derzeit Krieg herrscht, auf sich, um die letzte Ruhestätte Althammers ausfindig zu machen. Über dieses Abenteuer berichtet er nun exklusiv für das Onlinemagazin da Hog’n:
„Ich hatte eine Tagung in Polen, nämlich in Kreisau südlich von Breslau in Niederschlesien, hinter mir. Im Anschluss fuhr ich dann per Zug Richtung Osten durch ganz Polen bis fast zur ukrainischen Grenze. Schon in der Grenzstadt Przemysl waren Bahnhofsvorplatz, Schalterhalle und Bahnsteige Tag und Nacht von Menschenmassen belagert. Deshalb war es schwierig, überhaupt zu den Schaltern vorzudringen um eine Fahrkarte zu kaufen.
Kommunikation in der Ukraine sehr schwierig
Genauso war später in der ersten ukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) Geduld gefragt. Eine wunderschöne Stadt mit gänzlich erhaltenem historischen Zentrum. Die Bahnsteige hüben wie drüben voller ausreisender Frauen jeglichen Alters und Kindern mit viel Gepäck. Wobei ich mich immer wunderte, dass die alle in die ewig langen Züge hineinpassten. Was mich verblüffte: die Gegenzüge zurück in die Ukraine waren mindestens genauso voll – nur hatten die Rückkehrer noch mehr Gepäck dabei.
Ohne die vielen ehrenamtlichen, meist jüngeren Helferinnen und Helfer aus verschiedenen Ländern – unter anderem auch aus Amerika – wären die nicht einmal die steilen Bahnsteigtreppen mit ihren riesigen Koffern hinauf oder herunter gekommen, informiert und mit Getränken und Imbiss versorgt worden. Mir ist immer noch nicht klar, ob sie wirklich zurück wollen.

Ohne die hilfsbereiten Friedhofs-Hausmeister wäre Kurt Seul auf dem großen Gelände wohl verloren gewesen. Foto: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Eine Kommunikation ist in diesem Land sehr schwierig, da fast niemand (genügend) Englisch spricht. Angenehm war die 14 (!)-stündige Nachtreise nicht durch das riesige, flache Land und der großen Hitze in zum Teil nicht richtig klimatisierten Fernzügen nach Kiew und wieder zurück. Aber in der ersten, vergleichbar günstigen ersten Klasse ging es. An den Grenzen stand der Zug zwei bis drei Stunden – bis viele Hunderte von Fahrgästen durch ukrainisches Militär überprüft worden waren. Überwiegend schicke junge Frauen mit Schutzweste und umgehängtem Gewehr. Höflich und gelassen.
Vom Krieg merkte man im von mir bereisten westlichen und zentralen Landesteil wenig. Denn die russische Invasion vom Norden her nach Kiew scheiterte ja in den nördlichen Vororten (Stichwort: Massaker von Butscha) der riesigen Stadt und wurde dann – nur vorläufig, befürchte ich – abgebrochen, um sich auf die Ostukraine zu konzentrieren. Die von mir gesuchten beiden Friedhöfe befanden sich 20 Kilometer südlich der Stadt. Dort also, wo es bislang keine Kampfhandlungen gegeben hatte. Insofern war mir nicht bange.
Mit EU-Pass ein ungewöhnlicher Gast
Doch sah man immer wieder entlang der Bahnlinien einzelne Panzersperren. Gelegentlich auch an Ausfallstraßen, mit kleineren provisorischen Verteidigungsstellungen hinter Sandsäcken. Strengstens bewacht wurden allerdings Ein- und Ausgänge des Kiewer Hauptbahnhofs. Wie auf unseren Flughäfen mit Personen- und Gepäckkontrollen – aber durch schwerbewaffnetes Militär. Mit meinem EU-Pass war ich zwar ein ungewöhnlicher, aber vertrauenserweckender Gast, hatte ich das Gefühl. Oder es lag an meinem fortgeschrittenem Alter.
Ein paar Tage zuvor hatten die Russen mal wieder eine Rakete auf das Kiewer Zentrum abgefeuert. Wohl um zu zeigen, dass sie jederzeit überall zuschlagen könnten. Mein Ibis-Hotel in der Nähe des Hauptbahnhofs war ausgezeichnet, doch das Zimmer hoch oben im 14. Stock hätte wohl eine wunderbare Zielscheibe beim Beschuss dieses zentralen Verkehrsknotenpunkts des Landes abgegeben. Ich blieb nur eine Nacht.
Nach der langen Nachtfahrt bis Kiew zog ich sofort samt Rollkoffer los, um den Soldatenfriedhof aufzusuchen. Es war schwierig, den richtigen Vorortzug zu finden in dem Wahnsinnsverkehr der Großstadt, bei Verständnisproblemen und den unfreundlichsten, grantigsten und total gestressten Schalterbeamtinnen, mit denen ich je zu tun hatte. Gott sei Dank konnte ich die kyrillsche Schrift recht gut lesen.
Ein kleines Wunder!
Den Friedhof selbst fand ich nur Dank der Hilfe eines Sitznachbarn in der „Metro“ (hier allerdings eine Art S-Bahn), irgendwo im Nirgendwo entlang der Autobahn nach Odessa. Dies zwar nicht am angegebenen Ort, sondern ein paar Kilometer zurück Richtung Kiew im Kleinbus, den ein hilfreicher Mann für mich anhielt. An seinem Kopfschütteln und Gemurmel war unschwer abzulesen, dass er mich für verrückt hielt – in einem Land im Kriegszustand ein Grab zu suchen von einem Verwandten, der vor 81 Jahren gefallen war. Er hat damit wohl nicht ganz unrecht.
Gut, dass ich direkt nach der Ankunft am Bahnhof ohne Frühstück losgezogen war. Denn sonst hätte ich das gesuchte Grab möglicherweise nicht gefunden. Zufällig war nämlich an diesem Morgen das ältere Ehepaar vor Ort, das sich um die große Anlage kümmert, d.h. vor allem das Gras mäht. Und die Frau konnte sogar ausreichend Deutsch. Ein kleines Wunder! Wegen der unerträglichen Hitze wären die beiden am Vormittag schon wieder weg gewesen.
Das Grab von Althammer sah einsam und verlassen aus
Zwar war der Gräberblock auf dem Übersichtsplan der Eingangspforte an der Kapelle eingezeichnet. Aber schon den im Rasen eingelassenen Stein mit der Reihennummer hätte ich wegen des Heus und Erdreichs darauf nicht gesehen. Von ihm aus war die Grabstelle vor einem nicht beschrifteten großen Granitkreuz (das Linke von dreien) nur durch Zählen von Schritten in dieser Richtung auszumachen.
Leider konnte ich nicht die gesamte Gräberanlage abschreiten. Ich weiß nicht einmal, wie viele Einzelgräber es gibt bzw. ob ein Großteil der Gefallenen in Massengräbern bestattet wurde. Dies werde ich aber noch durch die beiden fleißigen Leute, die bestimmt für wenig Geld die Anlage in Schuss halten, erfahren. Sie hatten sich wiederholt entschuldigt, dass der vertrocknete Grasschnitt noch nicht weggerecht war.

Josef Althammer ist neben vielen anderen Gefallenen auf einer Gedenktafel am Kiewer Soldatenfriedhof verewigt.
Noch weiß ich nicht, ob überhaupt und wie oft Angehörige von Gefallenen den Friedhof besuchen. Er sah jedenfalls einsam und verlassen aus. Vor einem Kreuz war im Rasen ein Gedenkstein mit eingraviertem Namen zu sehen. Jedenfalls war ich der erste Besucher am Grab von Josef Althammer – und hoffentlich nicht der letzte!
Das zweite Ziel meines Unternehmens habe ich zu meinem Bedauern nicht erreicht: Schitomir. Ein Name, der den Fürholzer Fenzl-Geschwistern jedesmal vor Augen erscheint, sobald die Blaskapelle auf dem Friedhof das Lied „Ich hatt‘ einen Kameraden“ spielt. In dieser Stadt befindet sich heute noch der gleich zu Beginn des Russlandkriegs von der Wehrmacht angelegte deutsche Soldatenfriedhof. Zuletzt mit über 3.000 Gefallenen belegt. Irgendwo im großen gleichnamigen Verwaltungsbezirk auch das Dorf „Krasnoretschka“ – dem offiziellen Todesort des damals Einundzwanzigjährigen.
„Ich war wohl zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort“
Einen dortigen Halt hatte ich auf der Rückreise geplant. Doch auf dem Bahnhof Kiew habe ich es nicht geschafft, eine Fahrkarte zu erwerben, wurde immer an einen anderen Schalter verwiesen. So erging es aber auch vielen Einheimischen. Immer wieder neu Schlange stehen, lange Diskussionen mit der Beamtin, dann drängelt man sich an der nächsten Luke vor. Als mir die Kartenverkäuferin dann mal die Luke vor der Nase zuschlug – angeblich kannte oder verstand sie den Namen der Stadt nicht – hatte ich die Faxen dick und erwarb ein Ticket zurück an die polnische Grenze, wo ich im selben Ort und ebenfalls um Mitternacht eintraf. Wie schon auf der Hinreise.
Nein, irgendwie ist die Ukraine nicht mein Land. Ich war wohl zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Mit dem Direktzug nach Wien klappte es auf Anhieb, erstaunlicherweise gab es viel weniger Flüchtlinge an Bord. Über Südpolen, die alte polnische Königsstadt Krakau sowie Kattowitz im früher deutschen Niederschlesien ging es quer durch Tschechien bis Wien. Die Reise endete aber abrupt in Linz, also nur etwas mehr als eine Stunde von Passau entfernt, da es ab 22 Uhr keine Nachtverbindung mehr gab. Am nächsten Morgen hatte ich jedenfalls eine insgesamt über 4.000 Kilometer lange Zugreise hinter mir. Ein Abenteuer, das ich wohl so schnell nicht mehr vergessen werde.“
Kurt Seul