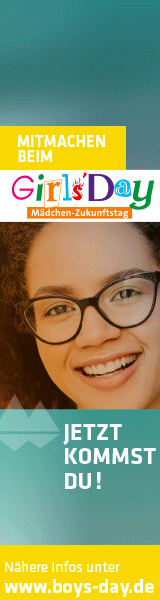Příbram/Bayerwald. Die ersten Příbram-Madonnen sind ab 1675 nachweisbar, geschnitzt von berufsmäßigen Bildhauern aus der 1216 erstmals urkundlich erwähnten Stadt in Mittelböhmen und deren umliegenden Orten. Im 18. Jahrhundert schnitzten sie größtenteils die Bergknappen aus den Silber- und Bleibergwerken Příbrams, die damit ihren geringen Lohn aufbesserten und im Alter ihren Lebensunterhalt damit bestritten.

Das massenweise Schnitzen immer desselben Příbram-Madonnen-Motives brachte auch eine stilistische Vereinfachung mit sich.
Mit Beginn des 19. Jahrhunderts wurden die Madonnen serienmäßig gefertigt. Bewohner der in der Nähe Příbrams liegenden Dörfer Deutsch-Nepomuk und Neudorf (Žalany) stellten sie in großer Stückzahl her. Die Bewohner dieser Enklave, um 1727 hier angesiedelt, sprachen bairischen Dialekt und stammten ursprünglich aus dem Böhmerwald. Sie fertigten sei jeher Holzwaren und arbeiteten mit einfachsten Werkzeugen wie Stemmeisen, Messer und Reifmesser.
Die bei bayerischen Pilgern beliebte „Hoizscheidlmadonna“
Ab dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts wurden in beiden Dörfern enorme Stückzahlen hergestellt: Zehn Madonnen pro Tag und Familie waren dabei keine Ausnahme. Es entstand eine regelrechte Hausindustrie mit Arbeitsteilung innerhalb der Familie. Das massenweise Schnitzen immer desselben Motives brachte auch eine stilistische Vereinfachung mit sich. Das Ergebnis war eine Art Hochrelief mit unbearbeiteter Rückseite und prismenförmiger Standfläche.
 Herausgearbeitet wurden die Figuren aus Kiefernstämmen, welche – auf die gewünschte Länge geschnitten – mehrfach radial gespalten wurden. Diese Scheite wurden dann auf die passende Dicke zugeschnitten. Von den bayerischen Pilgern wurden die Figuren deshalb auch „Hoizscheidlmadonna“ genannt. Variabel waren die Größen der Figuren – von 15 Zentimeter bis einen Meter -, wobei die größeren Skulpturen für Kapellen und Bildstöcke vorgesehen waren.
Herausgearbeitet wurden die Figuren aus Kiefernstämmen, welche – auf die gewünschte Länge geschnitten – mehrfach radial gespalten wurden. Diese Scheite wurden dann auf die passende Dicke zugeschnitten. Von den bayerischen Pilgern wurden die Figuren deshalb auch „Hoizscheidlmadonna“ genannt. Variabel waren die Größen der Figuren – von 15 Zentimeter bis einen Meter -, wobei die größeren Skulpturen für Kapellen und Bildstöcke vorgesehen waren.
Gefertigt und an die Pilger verkauft wurden auch Madonnen, die nicht dem Příbramer Gnadenbild nachempfunden waren. Dargestellt wurden Maria (hier mit Zepter) und das Jesuskind mit der Weltkugel in den Händen. Aufkäufer übernahmen die Figuren von den Schnitzern und fassten sie in eigenen Betrieben. Das ist auch der Grund, warum die Farbgebung sehr einheitlich ist: blau der Mantel, rot das Unterkleid, gelb der Saum und grün der Sockel. Die Farbe der Krone ist aus Waschgold.
Bis zu 300.000 pilgerten zum Heiligen Berg
Abnehmer dieser polychrom gefassten Madonnen waren Pilger, die in großen Scharen aus dem Bayrischen Wald und den angrenzenden Randbezirken betend zum Heiligen Berg zogen und dort ihre Sorgen und Bitten der Mutter Gottes anvertrauten. Schon kurz nach 1800 – Aufklärung und Säkularisation brachten das Ende der hiesigen Wallfahrten und Bittgänge – machten sich viele gläubige Menschen aus dem ostbayerischen Raum auf den Weg nach Böhmen, zu jenem Heiligen Berg.
 Die Blütezeit erfuhr diese Wallfahrt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: von Bodenmais, Zwiesel, Frauenau, St. Oswald und sogar von Tittling aus zogen die Menschen Richtung böhmische Grenze, wo sich ihnen immer mehr weitere Pilger zu einer „Kreuzschar“ anschlossen. Bis zu 1.500 Beter konnte so ein Zug umfassen, der an die sieben Tage unterwegs war. Unsägliche Strapazen, Regen, brennende Sonne und schlechte Wege nahm man in Kauf, um die wundertätige Madonna vom Heiligen Berg zu sehen, zu berühren und sie im Gebet um Hilfe zu bitten und Gottes Segen für Gesundheit und eine gute Ernte zu erflehen.
Die Blütezeit erfuhr diese Wallfahrt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: von Bodenmais, Zwiesel, Frauenau, St. Oswald und sogar von Tittling aus zogen die Menschen Richtung böhmische Grenze, wo sich ihnen immer mehr weitere Pilger zu einer „Kreuzschar“ anschlossen. Bis zu 1.500 Beter konnte so ein Zug umfassen, der an die sieben Tage unterwegs war. Unsägliche Strapazen, Regen, brennende Sonne und schlechte Wege nahm man in Kauf, um die wundertätige Madonna vom Heiligen Berg zu sehen, zu berühren und sie im Gebet um Hilfe zu bitten und Gottes Segen für Gesundheit und eine gute Ernte zu erflehen.
An zwei Hauptfesttagen trafen sich die Gläubigen dort. Der erste war der dritte Sonntag nach Pfingsten: Dabei handelte es sich um die sog. Krönungswallfahrt in Erinnerung an die Krönung der Statue am 22. Juni 1732. Der zweite war der Sonntag nach Maria Himmelfahrt, also nach dem 15. August. An diesen Tagen und während des übrigen Jahres summierte sich die Anzahl der Wallfahrer, die auch aus Böhmen, Polen und Schlesien zum Heiligen Berg zogen, auf schier unglaubliche 300.000 Menschen.
Drei Mark für eine Madonna
Jeder dieser Wallfahrer nahm einige geweihte Andenken mit nach Hause: Dienstboten und Inleute in der Hauptsache Rosenkränze, Kerzen, Wachsstöcke und Heiligenbilder. Bauersleute und die besser gestellten Selbständigen konnten sich auch eine Madonna leisten, welche damals, um das Jahr 1900, rund drei Mark kostete. In den bereits halbleeren Rucksäcken wurden diese zuhause dann hoch verehrten Devotionalien voller Stolz und Freude in die bayerischen Dörfer getragen.
von Heimatkundler Max Raab