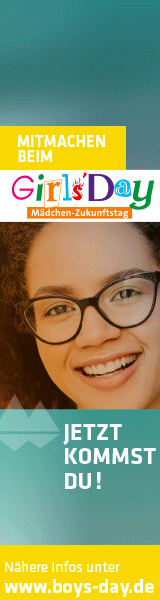Sie durfte am Bauernhof in keinem Troadkasten fehlen, für den Brauer bzw. Mälzer war sie zum Umschichten des Malzes auf der Darre unabdingbar, auf der Tenne wurde das Gsott mit ihr gemischt – und der Müller hatte sie ebenfalls im Einsatz: die Holzschaufel.
Angefertigt wurden diese stabilen „Waldwaren“ aus bestem Buchenholz. Der Schaufelmacher brauchte dazu Stämme von mindestens 80 Zentimeter Durchmesser – astrein und fehlerfrei. Deshalb suchte er die geeigneten Buchen auch selber im Wald aus und fällte sie eigenhändig. Auf die entsprechende Schaufellänge zugeschnitten – das heißt: Schaufelblatt inklusive Stiel zirka 150 Zentimeter – wurden die Stammabschnitte an Ort und Stelle gekloben (gespalten). Auf die so mit Axt und Keilen herausgearbeiteten, rund zehn bis zwölf Zentimeter dicken „Pfoschn“ (Bohlen) wurden mittels Schablone die groben Umrisse der Schaufel übertragen. Die weitere, raue Bearbeitung mit der Axt erfolgte noch an Ort und Stelle, sprich: im Wald.
Brauer-, Mälzer- und Getreideschaufel
Die endgültige Form bekamen die Rohlinge im Hause des Schaufelmachers in der Stube, wo auch geschlafen und gegessen wurde – oder, wenn vorhanden, im Schuppen. Eingespannt zur Bearbeitung wurden die Werkstücke in die Hoazlbank (Schnitzbank) oder in einen, mit einigen Bohrlöchern versehenen, aufrecht in der Stube stehenden Pfosten, in den der Stiel eingeklemmt wurde.
 Die flache, rund 40 Zentimeter breite Brauer- oder Mälzerschaufel wurde mit Reifmesser und Schabeisen bearbeitet. Die etwas schmälere Getreideschaufel, die tiefer ausgehöhlt war, wurde zusätzlich mit einem Dexel, einem gerundeten, scharfgeschliffenen Haueisen, traktiert. Der Stiel wurde mit Reifmesser und Rundhobel geformt. Gemein war beiden Schaufeltypen, dass der Stiel nicht an das Schaufelblatt angesetzt war, sondern mit dem Blatt aus dem Buchenpfoschen herausgearbeitet wurde. Somit konnte er nicht wackeln oder sich lösen.
Die flache, rund 40 Zentimeter breite Brauer- oder Mälzerschaufel wurde mit Reifmesser und Schabeisen bearbeitet. Die etwas schmälere Getreideschaufel, die tiefer ausgehöhlt war, wurde zusätzlich mit einem Dexel, einem gerundeten, scharfgeschliffenen Haueisen, traktiert. Der Stiel wurde mit Reifmesser und Rundhobel geformt. Gemein war beiden Schaufeltypen, dass der Stiel nicht an das Schaufelblatt angesetzt war, sondern mit dem Blatt aus dem Buchenpfoschen herausgearbeitet wurde. Somit konnte er nicht wackeln oder sich lösen.
In einigen Gegenden des Bayerischen Waldes wurden Schaufeln hergestellt, bei denen der Stiel extra gefertigt wurde. Die Verbindung von Blatt und Stiel erfolgte mit Holznägeln und zusätzlich mit Blechstreifen. Der Holzbedarf war bei dieser Variante geringer, ebenso der Zeitaufwand. Diese Schaufel hatte einen dementsprechend günstigeren Preis, dafür eine geringere Lebensdauer.
Fünf Euro pro Stück
Ein versierter Schaufelmacher konnte am Tag etwa zwei einteilige Schaufeln anfertigen. Er erzielte dabei für eine Schaufel – umgerechnet auf die heutige Kaufkraft – einen Preis von etwa fünf Euro pro Stück. Die Schaufeln wurden schockweise (ein Schock = 5 Dutzend = 60 Stück) an Händler verkauft. Diese verhausierten sie an Bauern, Müller und Brauereien.
Eine weitere Ausführung war die Brotschaufel, mit der die Brotlaibe in den heißen Backofen „eingeschossen“ und wieder entnommen wurden. Sie hatte ein flaches, rundes Blatt und einen angesetzten Stiel.
von Heimatkundler Max Raab