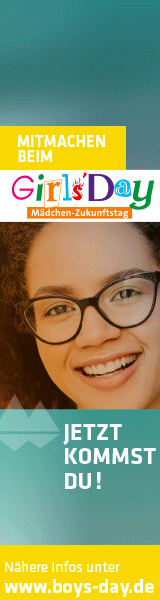Dienstag, 26. Mai: Es ist wahrlich kein leichter Job: Nachtschichten, lange Arbeitstage, anstrengende Abläufe – sowohl körperlich als auch psychisch. Dass (Kranken-)Pfleger täglich das leisten, was viele Menschen sich nicht zutrauen, ist allseits bekannt. Dass dieser Beruf zu jenen gehört, die nach wie vor unterbezahlt sind, ebenso.

Krankenpfleger sind „systemrelevant“, wie man seit diesem Jahr zu sagen pflegt. Sie leisten nicht nur in Krisenzeiten wertvolle Dienste für die Gesellschaft. Symbolfoto: pixabay.com/ parentingupstream
Doch diese Menschen sind unverzichtbar. Das Bewusstsein für diese Tatsache scheint sich in Corona-Zeiten gewandelt zu haben – mehr und mehr Leute erkennen, dass das Personal in Krankenhäusern und Seniorenheimen von elementarer Bedeutung ist. Die Pfleger sind nah dran am Patienten, bekommen häufig auch persönliche Schicksale mit und werden so zu unmittelbaren Bezugspersonen. Sie verrichten nicht nur körperliche Arbeit, sondern tragen durch medizinisches Wissen zur Gesundung jedes Einzelnen bei.
Helfen aus Leidenschaft
Krankenpfleger sind „systemrelevant“, wie man seit diesem Jahr zu sagen pflegt. 2020 – das Jahr des Lockdowns, des neuartigen Coronavirus und der damit einhergehenden Umstände: Besondere Schutzmaßnahmen wie die notfallmäßige Eröffnung einer „Corona-Station“ sollen die Versorgung Erkrankter sicherstellen und dem Schutz anderer Patienten sowie der Krankenhausmitarbeiter dienen.
Alexander Resch ist einer der Pfleger, der in Passau auf der neu eröffneten Covid-19-Station tätig ist. Der 24-Jährige arbeitet seit zwei Jahren im internistischen Bereich des Klinikums Passau. Nach seinem Schulabschluss absolvierte er 18 Monate den Bundesfreiwilligendienst („Bufdi“) in einem Krankenhaus. Danach stand sein Berufswunsch Krankenpfleger fest. „Am meisten hat mich überzeugt, Menschen aktiv helfen zu können und sie genesen zu sehen“, sagt Alexander Resch. Auch die Dankbarkeit, die die Patienten ihm immer wieder entgegenbringen, ist für den gebürtigen Hauzenberger viel wert: „Das macht es leichter, die Schattenseiten der Arbeit zu verkraften – beispielsweise mitzuerleben, wenn es Patienten schlechter geht – oder sie sogar sterben.“
Schutz von Patienten und Mitarbeitern steht an erster Stelle
Natürlich bekommen auch er und seine Kollegen die aktuelle Corona-Situation deutlich zu spüren. Das Passauer Klinikum hatte schnell reagiert und bereits im März eine eigene Corona-Station eingerichtet. Das Haus verfügt über drei Intensiv-Stationen, von denen eine nun für die Betreuung von Corona-Patienten umgerüstet wurde. Alle Mitarbeiter des Krankenhauses sind angewiesen, durchgehend Masken zu tragen – zudem wurde im März ein Besuchsverbot verhängt, das nun wieder gelockert werden konnte. „Diese Lockerung entlastet uns Pfleger auch ein bisschen“, berichtet der 24-Jährige. „In den vergangenen Wochen waren meine Kollegen und ich häufig diejenigen, die Angehörige über den Zustand ihrer Lieben informiert haben. Das ist ein Mehraufwand. Zudem möchte man in so einer Zeit vermehrt für diejenigen Patienten da sein, die sich ohne Besuch einsam fühlen.“

Zählt mittlerweile zur Standardausrüstung: Mundschutz, Handschuhe, Desinfektionsmittel. Symbolfoto: pixabay.com/ KlausHausmann
Die Corona-Station beinhaltet einen Isolationsbereich, um die Weitergabe des Virus an Mitarbeiter und Mitpatienten zu verhindern. Wenn im Krankenhaus der Verdacht besteht, jemand könne an dem Virus erkrankt sein, wird der für diese Fälle eingerichtete Konsildienst informiert. Die zuständigen Oberärzte entscheiden dann, ob die Person auf die Corona-Station verlegt wird. Dafür verfügt das Klinikum über eine ausreichende Anzahl an Test-Kits, um schnelle Ergebnisse zu gewährleisten.
Ein positiver Test ist jedoch erstmal kein Grund zur Panik: „Viele Patienten haben milde Verläufe und benötigen keine intensivmedizinische Betreuung“, berichtet Alexander Resch. Einige Patienten kämen auch vorsorglich ins Krankenhaus, anstatt sich für eine Quarantäne zu Hause zu entscheiden: „Das sind meistens Menschen, die Risikogruppen angehören – beispielsweise ältere Mitbürger oder Leute mit Vorerkrankungen“, verdeutlicht der Pfleger.
„Schon a bissal Angst“
Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, seien die Stationsmitarbeiter zu Beginn der Umstellungen gut auf die neue Situation vorbereitet worden: Das Personal wurde entsprechend eingearbeitet, um schnell eine gewisse Routine bei neuen Abläufen zu bekommen. Trotzdem habe er zur Anfangszeit „schon a bissal Angst“ gehabt, meint Alexander Resch. „Es gab täglich neue Informationen und neue Maßnahmen, die umgesetzt werden sollten – auch aufgrund der zur Verfügung gestellten Ausrüstung war dies möglich.“ Die Pflegedirektion des Krankenhauses orientiere sich dabei sehr an den Angaben und Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes und gebe die Richtlinien schnellstmöglich an die Mitarbeiter weiter.

„Planbare Eingriffe wurden verschoben, damit wir Einzelzimmer für Verdachtsfälle haben und im Notfall auch Patienten auf der Intensivstation beatmen können.“ Symbolfoto: pixabay.com/ orlobs
Der Krankenpfleger ist froh über die Vorgehensweise seines Arbeitgebers: „Ich habe das Gefühl, die Situation wird ernst genommen, es wird aber keine Panik verbreitet. Planbare Eingriffe wurden verschoben, damit wir Einzelzimmer für Verdachtsfälle haben und im Notfall auch Patienten auf der Intensivstation beatmen können.“ Die Bilder, die man aus anderen Ländern kennt, rufen in ihm ein mulmiges Gefühl hervor, sagt der 24-Jährige. Mittlerweile habe er jedoch keine Angst mehr, dass es in Deutschland zu einer ähnlichen Überlastung der Krankenhäuser kommen könnte: „Derzeit sieht es nicht danach aus. Es gibt genügend Personal, Platz und Geräte, um Situationen wie in Italien zu vermeiden.“
Gegen Dienstende desinfizieren die Mitarbeiter sämtliche Oberflächen, damit eine (zu schnelle) Verbreitung des Virus verhindert werde. Auch dies sei anfangs ungewohnt gewesen: „Wenn solche Neu-Anweisungen kommen, macht man sich zunächst über jeden Handgriff Gedanken.“ Mittlerweile haben sich Alexander Resch und seine Kollegen an die neuen Abläufe gewöhnt – und machen gerne auch mal zehn Minuten später Feierabend, damit alles steril und sauber ist. Denn dies – und da ist sich der Pfleger sicher – ist einer der Gründe, warum Deutschland im internationalen Vergleich bislang eher verschont geblieben ist: „Man hat schnell reagiert, Informationen wurden flott weitergegeben und die Beschränkungen schnell angeordnet.“
„Ich möchte meine Angehörigen nicht in Gefahr bringen“
Deshalb sei es ihm umso wichtiger, weiterhin vorsichtig zu bleiben: „Ich gehe nicht übermäßig viel raus und versuche, selten einkaufen zu gehen – die Gefahr, sich dort zu infizieren ist wahrscheinlich größer als im Krankenhaus, wo alle professionelle Masken tragen.“ Da er alleine wohnt, hält der 24-Jährige auch beim Besuch seiner Eltern Abstand. „Ich möchte meine Angehörigen nicht in Gefahr bringen und gleichzeitig natürlich auch die Patienten schützen. Für den Pfleger hat sich durch die Corona-Krise einiges geändert, doch er ist sich sicher: „Die Maßnahmen sind wichtig, damit wir die Situation gut überstehen.“ Und damit er irgendwann auch wieder ohne Mundschutz zu den Patienten kann, um ihnen sein Lächeln zu schenken.
Malin Schmidt-Ott