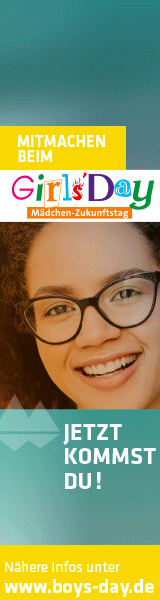Philippsreut. Wer heute vom Lusen über den Plattenhausriegel zum Rachel wandert, merkt davon eigentlich nichts mehr. Der ein oder andere Grenzstein ist zu sehen – aber von Stacheldraht, Stromzaun oder gar Minen ist keine Spur. Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer sowie der Eiserne Vorhang, die eine jahrzehntelange Teilung Europas in Ost und West manifestierten. Einer der wenigen bayerischen Grenzübergänge befand sich in Philippsreut. Die Zone, die sich auf der gegenüberliegenden Seite befand, kostete vielen Menschen, die etwa Fluchtversuche unternahmen, das Leben – bis die Grenze plötzlich weg war.

„Doch mehr als ein Blick mit dem Fernglas war meist nicht drin. Und auch dann sah man bestenfalls nur ein paar Wachtürme.“ Symbolfoto: pixabay/ Free Photos
„Ich habe damals nie verstanden, warum ich da nicht rüber darf“, erinnert sich Josef „Joe“ Grünzinger. Der heute 75-jährige Freyunger war sieben Jahre beim Bundesgrenzschutz und patrouillierte im Bayerischen Wald an der Grenze zur Tschechoslowakei. Der Nachbarstaat im Osten, so erklärt er rückblickend, sei für ihn damals „ein fremdes Land“ gewesen. Dass die Städte Krumau oder Budweis nur einen Katzensprung entfernt sind, dass der Moldaustausee „keine Froschlocka“, sondern ein richtiger „See“ ist, war für ihn zu jener Zeit unvorstellbar. Was „dort drüben“ sei, habe ihn „brennend interessiert“, doch mehr als ein Blick mit dem Fernglas war meist nicht drin. Und auch dann sah man bestenfalls nur ein paar Wachtürme.
Die Erfindung des „Eisernen Vorhangs“
Auf der östlichen Seite des Eisernen Vorhangs befand sich die mehrere Kilometer breite Grenzzone, ein schier unüberwindbarer Streifen mit Zäunen, Stacheldraht, teilweise vermint. Auf bayerischer Seite sah die Grenze zur ČSSR dagegen relativ unspektakulär aus. Zunächst, unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, sicherten dort junge Männer in „bürgerlicher Kleidung“ die Grenze, wie es heute im „Begegnungsraum Geschichte“ heißt, einem Gemeinschaftsprojekt der Universität Passau und der Universität Budweis.

Der Freyunger Josef „Joe“ Grünzinger war zur Zeit des Kalten Kriegs sieben Jahre lang beim Bundesgrenzschutz tätig. Foto: Hog’n-Archiv
Neben Haidmühle und Bayerisch Eisenstein befand sich auch bei Philippsreut ein regulärer Grenzübergang. Nach Ankunft der Amerikaner 1946 wurde dieser Übergang geschlossen. Als 1950 eine Grenzaufsichtsstelle errichtet wurde, war der Korridor in den Osten so gut wie unpassierbar geworden. Wer sich unerlaubterweise im anderen Territorium befand, hatte mit empfindlichen Strafen zu rechnen. Die Schließung der Grenze diente dazu, den „Feind“ vom eigenen Staatsgebiet fernzuhalten, so lautete die offizielle Begründung – und zwar auf beiden Seiten. Wollten die einen den „Feind aus dem Osten“ abwehren, wehrten sich die anderen gegen „Agenten der imperialistischen Staaten“.
Am 5. März 1946 spricht der britische Premierminister Winston Churchill erstmals vom „Eisernen Vorhang“, der Trennlinie, die Europa und die Welt in zwei konträre Lager unterteilen sollte: Hier der kapitalistische Westen, dort der kommunistische Osten. Von nun an verschärfen sich die Beziehungen der jeweiligen Blockstaaten – auch jene zwischen der BRD und der Tschechoslowakei. Im Februar 1951 stationiert die tschechoslowakische Regierung daher 16.000 Soldaten entlang ihrer Staatsgrenzen. Für die Region Bayerischer Wald bedeutet der Eiserne Vorhang nicht nur einen Verlust an Bewegungsfreiheit, sondern allen voran eine zusätzliche wirtschaftliche Bürde. Das Grenzgebiet gilt nach dem Krieg als eines der wirtschaftlich rückständigsten, mit eklatant hohen Arbeitslosenzahlen.
Eine Grenze, die Systeme und Familien teilte
Noch im September 1950 ergab eine Volkszählung, dass mehr als ein Drittel der bayerischen Bevölkerung aus Vertriebenen besteht. Der Eiserne Vorhang zog nicht nur eine Grenze zwischen zwei politischen Systemen, sondern mitten durch Städte, Dörfer und Familien hindurch. Bevor man aus dem Osten kommend die bayerische Demarkationslinie erreichen konnte, musste innerhalb der Grenzzone ein dreiteiliger Zaun mit bis zu 15.000 Volt überwunden werden. Das Gebiet um den Zaun herum war zu Anfangszeiten mit Minen versehen. Insgesamt 95 Menschen ließen an der bayerisch-tschechischen Grenze ihr Leben.

Etliche Kilometer Stacheldraht sind entlang der bayerisch-tschechoslowakischen Grenze verlegt worden. Foto: pixabay/ mnswede70
Von bayerischer Seite aus war der Eiserne Vorhang jedoch kaum als solcher wahrzunehmen. So heißt es im Grenzbericht aus dem Jahr 1980: „Die aufwendige, jedoch im Vergleich zur DDR-Grenze verhältnismäßig ‚human‘ gesicherte Grenze erscheint dem unkundigen Betrachter das Bild einer offenen Grenze, weil die tschechoslowakischen Grenzwachen die Sperranlagen unmittelbar an der Grenze abbauten und in das Hinterland verlegten“. Selbst ein Grenzbeamter wie Josef Grünzinger hatte daher kaum eine Vorstellung davon, was sich auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs genau abspielte.
Es dauerte bis in die 1970er, bis sich die Lage zwischen der BRD und der Tschechoslowakei zumindest etwas entspannte und erste diplomatische Beziehungen aufgenommen werden konnten. Einen ersten Vorboten künftiger Annäherung vermochte man im Jahr 1983 zu erahnen: Der bayerische Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß, ein als „Erzfeind der Kommunisten“ bekannter CSU-Hardliner, besuchte erstmals die Tschechoslowakei. Dass die Welt der zwei Systeme aber nur sechs Jahre später der Vergangenheit angehören sollte; davon wagte zu dieser Zeit keiner zu träumen. Im Jahr 1986 lösen tschechoslowakische Grenzbeamte einen Eklat aus, indem sie im Grenzgebiet auf Deutsche schießen – in der Meinung es seien Flüchtige aus dem eigenen Land. Auch das gehörte noch immer zum Alltag jener Zeit.
„Ein beklemmendes Gefühl“
Und plötzlich war sie weg. Die jahrzehntelange Teilung zwischen Ost und West, zwischen BRD und DDR, zwischen Bayern und der Tschechoslowakei; sie gehörte von einem Tag auf den anderen der Vergangenheit an. Bereits wenige Tage vor dem „Mauerfall“ in Berlin, nämlich am 3. November 1989, wurde der Grenzübergang in Philippsreut geöffnet.
Trotz all der Neugierde, die Josef Grünzinger über die Jahre hinweg verspürte, hinterließ der erste Eindruck „von drüben“ ein „beklemmendes Gefühl“, wie er heute sagt. Kirchen und Häuser wurden vernachlässigt, das gesamte Kulturgut der Grenzstadt Strážný (bis 1955 Kuschwarda) war größtenteils zerstört oder verfallen.

Das Ende der Bahn an der bayerisch-tschechoslowakischen Grenze bei Haidmühle. Foto: Hog’n-Archiv/Paulus
„Das habe ich mir so nicht vorgestellt“, erklärt Grünzinger. Dazu muss man wissen: Zur Errichtung der mehrere Kilometer breiten Sperrzone wurden die meisten Gebäude innerhalb dieses Gebiets abgerissen, die Bevölkerung wurde umgesiedelt. Insgesamt sind an der Grenze zu Bayern auf tschechoslowakischem Gebiet rund 200 ehemals sudetendeutsche Dörfer dem Erdboden gleich gemacht worden. Zwar siedelten sich nach 1989 wieder Menschen in der Gegend an, aber jene Gebäude, die im Kalten Krieg nicht beseitigt worden waren, befanden sich in einem desolaten Zustand.
Auch der Kontakt zur tschechoslowakischen Bevölkerung habe sich anfangs schwierig gestaltet. Als einstiger Grenzsoldat war Grünzinger häufig den Beamten aus dem Osten bei ihrer Patrouille begegnet, vor allem im Gebiet um den Lusen oder dem Rachel. „Man grüßte sich, die grüßten manchmal zurück – und dann verschwanden sie im Wald“. Denn Reden war den Tschechoslowaken nicht erlaubt. Entsprechend verhalten und reserviert seien erste Begegnungen mit dem ehemaligen „Feind“ nach der Wende abgelaufen.
Plötzlich war alles anders
Noch im Mai 1989 forderte der Grenzübergang bei Philippsreut ein letztes Opfer: Eine Frau fuhr mit ihrem Auto gegen den Schlagbaum. Ihr Sohn, Kevin Strecker, überlebte den Unfall nicht. Und nun, ein halbes Jahr später, war alles anders. Keine Grenze, kein Stacheldraht und erst recht keine Minen mehr. Menschen, die jahrelang nur erahnen konnten, was sich auf der anderen Seite befindet, kamen plötzlich miteinander ins Gespräch. Die Welt war für beide Seiten – von heute auf morgen – ein gewaltiges Stück größer geworden.
Grünzinger erinnert sich, dass anfangs viele Tschechoslowaken vor allem zum Einkaufen in den Westen gekommen waren, „vor allem zum Aldi“. Und natürlich waren die Wartezeiten an der Grenze in den Wochen nach der Öffnung besonders lang. Regelrechte Blechlawinen tingelten von Ost nach West und umgekehrt. Die Staus waren teils kilometerlang, erinnert sich Grünzinger. Teilweise habe man bis zu einer Stunde gewartet, bis es überhaupt losging mit dem „Papierkram“ an der eigentlichen Grenze.
Unmittelbar nachdem die Schranke gefallen war, gab es erste Bestrebungen der Behörden sich auszutauschen. Auch regelmäßige Veranstaltungen und Feierlichkeiten habe es von nun an im Grenzgebiet gegeben. Die Bürgermeister von Philippsreut und Strážný hielten Reden, dazu spielte Blasmusik. Ganz so, als wäre nie etwas gewesen.
Es ist an der Zeit, „sich endlich die Hände zu reichen“
Am 17. November 1989 wurde die tschechoslowakische Regierung gestürzt, bei den Wahlen im Dezember desselben Jahres der Menschenrechtler Václav Havel zum Präsidenten gewählt. Von nun an entspannten sich die Beziehungen zwischen BRD und Tschechoslowakei rasch. Havel gilt bis heute als einer der maßgeblichen Kräfte hinter der tschechisch-deutschen Aussöhnung. Bereits 1992 wird der „Deutsch-tschechoslowakische Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit“ unterzeichnet.

Die beiden Nationalpark-Chefs Pavel Hubený (links) und Dr. Franz Leibl machen’s vor. Foto: Hog’n-Archiv
Im Jahr darauf wird die „Euregio Bayerischer Wald/Šumava/Unterer Inn“ gegründet, um die grenzübergreifende Zusammenarbeit weiter zu fördern. Im selben Jahr bekommt auch Philippsreut eine neue, gut zwei Kilometer lange Umgehungsstraße. Regelrechte Verkehrskolonnen, die sich täglich durch die Ortsmitte quetschten, waren den Bewohnern nicht länger zumutbar.
Mittlerweile ist eine ganze Generation groß geworden, die all das nur noch aus Erzählungen kennt, für die „Eiserner Vorhang“ nur noch ein Begriff aus dem Geschichtsbuch ist – und die bei Philippsreut über die Grenze fährt, ohne etwaige Papiere vorzeigen zu müssen. „Nach so langer Zeit ohne Grenze“, sagt Joe Grünzinger, sei es an der Zeit „sich endlich die Hände zu reichen“.
Johannes Greß