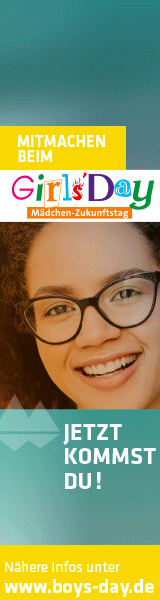Freyung-Grafenau. Stefanie und Anja, zwei Mütter aus dem Landkreis Freyung-Grafenau, haben beide ein Kind mit Down-Syndrom. Sie haben erst spät in der Schwangerschaft bzw. nach der Geburt erfahren, dass ihre Kinder ein Handicap haben. Vor wenigen Wochen diskutierte der Bundestag nun erstmals darüber, ob künftig die Krankenkassen einen Bluttest bezahlen sollen, mit dem man sehr sicher und ohne großes Risiko feststellen könne, ob das Ungeborene das Down-Syndom hat oder nicht. Doch: Was dann?

Die zweijährige Laura und die siebenjährige Lena haben das Down-Syndrom. Ihre beiden Mütter können sich ein Leben ohne sie heute nicht mehr vorstellen.
Der Ball rollt die Böschung hinunter. Die siebenjährige Lena will hinterher, ihn zurückholen. Die zwei Jahre jüngere Emilia ist schneller. Sie schnappt den Ball und rennt wieder hoch. Lena bleibt zurück und fängt an zu weinen. „Jetzt ist sie enttäuscht, dass sie zu langsam war“, sagt ihre Mama Stefanie Dietrich. Lena ist ehrgeizig, sie möchte so vieles gerne können, was andere Mädchen in ihrem Alter auch beherrschen.
„Die Ärzte haben getuschelt, sind aus dem Zimmer gegangen“
Lena lernt alles ein bisschen langsamer. Sie hat das Down-Syndrom, auch bekannt unter dem Namen „Trisomie 21“. Stefanie Dietrich sagt: „Ich bin ehrlich gesagt froh darüber, dass der Frauenarzt die Trisomie bei der Nackenfaltenmessung nicht erkannt hat.“ Sie selbst hätte wohl auch dann das Kind bekommen, wenn sie bereits vor der Geburt davon gewusst hätte – aber: „Mein Mann und ich wären dann vielleicht nicht mehr zusammen“, sagt sie. Denn ihr Mann kam in den ersten Tagen nach der Geburt nur schwer damit klar, dass seine Tochter eine Behinderung hat. Und wenn er schon in der Schwangerschaft davon erfahren hätte? Dann hätte er vielleicht einen Schwangerschaftsabbruch in Erwägung gezogen…

„Ich bin ehrlich gesagt froh darüber, dass der Arzt die Trisomie bei der Nackenfaltenmessung nicht erkannt hat“, sagt Lenas Mama Stefanie Dietrich.
Kurz nach Lenas Geburt merkte Stefanie, dass irgendetwas nicht in Ordnung sei. „Die Ärzte haben getuschelt, sind aus dem Zimmer gegangen“, erinnert sie sich. Dann sei der Frauenarzt zu ihr gekommen und habe ihr gesagt, dass ihre Tochter eine Behinderung habe. „Geistig oder körperlich?“, habe sie gefragt. „Beides“, antwortete der Arzt. Sie selbst habe Lena angeschaut und nur gedacht: „Es ist doch alles in Ordnung mit ihr!“ Stefanie Dietrich wusste zu dem Zeitpunkt nichts mit dem Begriff Down-Syndrom anzufangen. Im Krankenhaus habe sie sich anfangs ziemlich allein gelassen gefühlt: „Ich war als Mutter überfordert von der Situation“, resümiert sie heute.
Bluttest als Kassenleistung?
Dass sie und ihr Mann erst nach der Entbindung vom Down-Syndrom ihrer Tochter erfahren haben, ist eine Ausnahme. Stefanie Dietrich hat – wie viele andere Mütter – in der Schwangerschaft (etwa in der zwölften Woche) die so genannte Nackenfaltenmessung durchführen lassen. Die Mutter entscheidet dabei selbst, ob der Frauenarzt diese Untersuchung vornehmen soll. Stellt er dabei eine Flüssigkeitsansammlung im Nackenbereich fest, deutet dies auf eine Chromosomenabweichung hin – also darauf, dass das Kind von Trisomie betroffen ist.

Bei Lena wurde das Down-Syndrom erst nach der Geburt festgestellt. Mit ihrer kleinen Schwester Lisa versteht sie sich gut.
Sicher diagnostizieren lässt sich das Down-Syndrom erst durch weitere Untersuchungen. Eine Fruchtwasserpunktion war bisher die gängige Methode. Dieser Test kann jedoch in seltenen Fällen zu einer Fehlgeburt führen. Deshalb lassen immer mehr werdende Eltern heute per Bluttest eine Betroffenheit abklären: Dabei wird das Blut der Mutter untersucht, wobei ebenfalls mit recht hoher Wahrscheinlichkeit festgestellt werden, ob eine Trisomie vorliegt.
Dieser Bluttest kostet allerdings mehrere hundert Euro, die die Eltern aus eigener Tasche bezahlen müssen. Im April diesen Jahres hat eine Debatte im Bundestag hinsichtlich der Frage stattgefunden, ob dieser Bluttest von den Krankenkassen bezahlt werden soll. Kritiker befürchten, dass dann noch mehr Mütter ihr Kind abtreiben lassen könnten, wenn der Verdacht auf Trisomie 21 durch den Bluttest erhärtet wird. Einige Politiker fordern daher, dass der Bluttest nur für Risikoschwangere als Kassenleistung deklariert werden soll – und dies auch erst nach der zwölften Schwangerschaftswoche, wenn ein Schwangerschaftsabbruch nicht mehr ohne Weiteres durchgeführt werden kann. Im Spätsommer soll im Bundestag eine Entscheidung dazu fallen.
„Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Kind bekommen hätte“
Als Anja Weiss-Steinbrenner in der 34. Schwangerschaftswoche erfahren hatte, dass ihr Kind das Down Syndrom hat, brach für sie eine Welt zusammen. „Das sagt man im Vorhinein immer recht leicht, dass dies kein Grund ist abzutreiben“, erzählt die 35-Jährige. Wenn man aber in der Schwangerschaft gesagt bekomme, dass mit dem Kind etwas nicht in Ordnung ist, sei das etwas völlig anderes – dann mache man plötzlich sich sehr viele Gedanken. „Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Kind bekommen hätte, wenn schon bei einem Test in der Frühschwangerschaft das Down-Syndrom festgestellt worden wäre“, gibt Anja heute ganz offen zu.

„Im Nachhinein würde ich sie natürlich nie wieder hergeben.“ Anja Weiss-Steinbrenner mit ihrer Tochter Laura.
Mittlerweile ist ihre Tochter Laura zwei Jahre alt. Ein fröhliches Kind, das flott im Garten herumläuft, schaukelt und mit ihrer älteren Schwester Emilia im Sandkasten spielt. „Im Nachhinein würde ich sie natürlich nie wieder hergeben“, sagt Anja mit Nachdruck. Wenige Wochen vor der Geburt suchte sie den Kontakt zu Stefanie Dietrich. Anja und ihr Mann wollten wissen, was auf sie zukommt.
Dann haben sie Lena kennen gelernt. Sie meinte daraufhin: „Ich hätte mir das viel viel schlimmer vorgestellt.“ Worauf Stefanie Dietrich heute mit eine Lachen erwidert: „Und dabei hatte Lena einen ziemlich schlechten Tag, als ihr uns damals besucht habt.“
Als Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom könne und möchte sie anderen Müttern die Entscheidung niemals abnehmen, ob sie das Kind bekommen sollen oder nicht, sagt Stefanie Dietrich. „Ich sage allen: Kommt vorbei und macht euch selbst ein Bild.“ Anja Weiss-Steinbrenner berichtet, sie habe nach der Diagnose in der späten Schwangerschaft gedacht: „Das schaffe ich nicht.“ Ein Kind mit Down-Syndrom kennen zu lernen hatte ihr jedoch viele Ängste genommen.
„Sie braucht eben zu allem etwas länger“
Wie ist er also, der Alltag mit einem Down-Syndrom-Kind? „Wir machen mit Laura viel Physiotherapie, Ergotherapie, gehen zur Logopädin“, erzählt Anja. Das sei zwar aufwendig, doch seit Laura in den Kindergarten gehe, finde vieles dort statt. Ansonsten sei ihre Tochter charakterlich ihrer größeren Schwester ziemlich ähnlich. „Sie braucht eben zu allem etwas länger“, so die Mutter. Das sei der größte Unterschied.

Lena hat erst mit zwei Jahren laufen gelernt. Sie freut sich, wenn sie neue Dinge lernt, zum Beispiel an Turngeräten zu schaukeln.
Laufen gelernt hat Laura mit knapp zwei Jahren. Mit zweieinhalb spricht sie nur wenige Wörter wie Mama, Papa, Oma und Opa. Auch die siebenjährigen Lena wirkt oft wie ein jüngeres Kind, redet beispielsweise nicht so viel und nicht so deutlich wie andere Kinder in ihrem Alter. „Ich verstehe sie immer“, sagt Mama Stefanie Dietrich. Bei Lena habe es lange gedauert, bis sie sich verständigen konnte. „Als sie drei Jahre alt war, haben wir mit Gebärden angefangen“, erzählt die 30-Jährige. Das habe enorm geholfen. Sie hat schnell viele Gebärden gelernt und konnte sich mitteilen.
Größere körperliche Einschränkungen haben weder Lena noch Laura. Keine der beiden hat einen Herzfehler, der bei Kindern mit Down-Syndrom häufiger auftreten kann als bei gesunden Kindern. Laura hat einen Nierenstau, der sich noch verwachsen könne oder irgendwann einmal operiert werden müsse. Lena kam mit verengten Lungengefäßen zur Welt. Eine Sauerstofftherapie habe geholfen, nach wie vor werde sie aber regelmäßig untersucht.
„Man hat immer Angst: Passt alles?“
Die vielen Untersuchungen sind wohl das, was den Alltag mit einem von Trisomie 21 gehandicapten Kind am schwierigsten macht. „Man hat immer Angst: Passt alles?“, erzählt Stefanie Dietrich. Und auch ihre Tochter Lena habe Angst vor den Untersuchungen – Arztbesuche könne sie gar nicht leiden. Mittlerweile sei die kleine Schwester Lisa dabei jedoch eine große Hilfe: „Sie zeigt ihr beim Kinderarzt, dass die Untersuchung nicht schlimm ist“, berichtet die Mutter.
Ansonsten gestalte sich ihr Alltag ziemlich normal. Wie bei allen Kindern seien manche Tage anstrengender – und manche eben nicht. „Lena ist sehr feinfühlig und bockelt viel, wenn sie einen schlechten Tag hat“, sagt Stefanie. An solchen Tagen könne man ihr nichts recht machen. Dann gebe es aber wieder Tage, an denen Lena viel mit ihrer dreijährigen Schwester Lisa spielt – und alles problemlos laufe: „Gestern waren wir zum Beispiel im Freibad und es war so toll. Ein perfekter Tag.“
Was sowohl bei Laura als auch bei Lena auffällt: Sie sind Fremden gegenüber sehr aufgeschlossen, lächeln sofort jeden an. „Es gibt Leute, die winken dann zurück, andere drehen sich aber weg“, berichtet Anja Weiss-Steinbrenner. Ihr sei etwa im Urlaub in Österreich aufgefallen, dass dort viele Menschen sehr freundlich auf Laura reagiert hätten. „Bei uns hat man immer das Gefühl, dass die Leute schauen.“
Sabine Simon
Übrigens: Anja Weiss-Streinbrenner und Stefanie Dietrich treffen sich regelmäßig mit anderen Müttern in der „Downy-Gruppe“ in Freyung. Hier geben sich die Mütter seit drei Jahren Tipps oder reden einfach nur über ihren Alltag, während die Kinder miteinander spielen. Die „Downy-Gruppe“ trifft sich jeden letzten Samstag ungerader Monate von 14 bis 16 Uhr in der Praxis für Logopädie von Susanna Duschl.