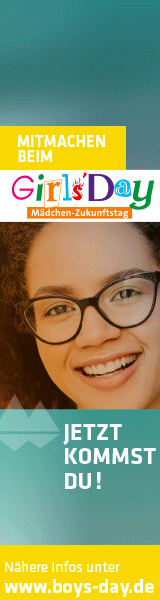Freyung/Prag/München. „Wir erleben gerade eine sehr erfreuliche Periode der Beziehungen zwischen unseren Staaten – und das ist alles andere als selbstverständlich.“ Mit diesen Worten wandte sich jüngst die tschechische Generalkonsulin Kristina Larischovà im Rahmen der Ausstellungseröffnung „Diplomatie zwischen Prag und Berlin – ein doppelter Anfang 1918/1993“ in Freyung an ihr (überwiegend niederbayerisches) Publikum. Man wisse um die Notwendigkeit des gegenseitigen Bemühens, „dass die bilateralen Beziehungen und die gute Nachbarschaft ein solides und breites Fundament bekommen“.

Generalkonsulin Kristina Larischovà (Mitte) bei der Eröffnung der Ausstellung „Diplomatie zwischen Prag und Berlin – ein doppelter Anfang 1918/1993“ in der Freyunger Sparkasse. Sie wird flankiert von (v.l.) Vorstandsvorsitzender Stefan Prosser, Alt-Landrat Alfons Urban, Landrat Sebastian Gruber, Jaroslava Martanová (Bürgermeisterin Vimperk) und Zdeněk Lyčka (Tschechisches Außenministerium Prag). Foto: Landratsamt FRG
Wir wollten mehr über den aktuellen Stand der deutsch-tschechischen Beziehungen von Generalkonsulin Larischovà wissen – und haben sie unter anderem danach gefragt, was passieren muss, damit die immer noch vorhandenen Grenzen in den Köpfen der Leute verschwinden.
Politische Annäherung als langwieriger Prozess der Aufarbeitung
Frau Larischovà: Wie hat sich das Verhältnis zwischen Deutschland und Tschechien nach dem Fall des Eisernen Vorhangs entwickelt? Wie nach der friedlichen Teilung Tschechiens von der Slowakei 1993?
Die große Wende von 1989 wurde anfangs mit Jubel, aber schrittweise auch mit gemischten Gefühlen auf beiden Seiten der Grenze begleitet. Auf der einen Seite gab es viel Hoffnung und Begeisterung, auf der anderen Seite auch viele Befürchtungen. Die Tschechen und Slowaken hofften auf ihre Rückkehr nach Europa, auf Überwindung der Teilung Europas und auf einen freiheitlichen Weg zur Prosperität. Die Öffnung von Grenzen wurde allerdings auch mit negativen Emotionen und Ängsten verknüpft: Die Tschechen haben befürchtet, dass es zur sprungartigen Preissteigerung kommt – und die Deutschen haben ihre Arbeitsplätze durch billige Arbeitskräfte aus dem Osten bedroht gesehen.
Mit der Vereinigung Deutschlands im Jahre 1990 ist plötzlich in unserer westlichen Nachbarschaft ein Riese mit 80 Millionen Einwohnern entstanden. Die Wirtschafts- und Bevölkerungsasymmetrien zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Tschechien haben sich nach der friedlichen Trennung der Tschechoslowakei noch massiv vergrößert. Im Zuge der tschechischen wirtschaftlichen Transformation der 90er Jahre und vor allem im Zusammenhang mit der Privatisierung gab es bei manchen Tschechen Ängste vor einer deutschen Bevormundung und Dominanz. Heute gehören die Unternehmen mit dem deutschen Investitionskapital zu den erfolgreichsten auf dem Markt – und die deutschen Arbeitgeber gelten meistens als beliebt.
Für die politische Annäherung der Deutschen und Tschechen hat auch der langwierige Prozess der Aufarbeitung der Nachkriegsgeschichte eine große Rolle gespielt. Beide Seiten haben mittels der Regierungserklärung von 1997 einen guten Weg gefunden, der es beiden Seiten ermöglicht hat, sich in erster Linie auf ihre gemeinsame Zukunft im Rahmen des zusammenwachsenden Europas zu konzentrieren. Heutzutage sind die bilateralen Beziehungen auf dem besten Niveau der Neuzeit.
„Für das Nachbarland interessieren sich eher ältere Leute“
Wichtig ist auch der breitere internationale Kontext für unsere Beziehungen – zum ersten Mal in der modernen Geschichte sind unsere Staaten Verbündete und Mitglieder wichtiger internationaler Organisationen wie der EU, der NATO, der OSZE und der UNO, bei denen wir auch erfolgreich zusammenarbeiten.
Deutschland ist zum tschechischen Schlüsselpartner in der EU geworden. Die Außenminister haben im Juli 2015 ein gemeinsames Dokument zum Strategischen Dialog beider Länder unterzeichnet – dieser knüpft an die oben genannte deutsch-tschechische Erklärung von 1997 an und strebt neben konkreter bilateraler Kooperation auch die gemeinsame Verantwortung für die Zukunft Europas an.
Die Vertreter der Zivilgesellschaften beider Länder arbeiten bereits seit 20 Jahren – dank der Existenz des deutsch-tschechischen Zukunftsfonds und des Gesprächsforums – gut zusammen. Seit dem Jahr 1998 hat der Zukunftsfonds mit insgesamt rund 57 Millionen Euro mehr als unglaubliche 10.300 Projekte unterstützt. Es steckt viel Arbeit und Elan dahinter. Mit anderen Worten: Wir haben gemeinsam in konkrete Projekte investiert und uns im Gesprächsforum über unsere gemeinsame Geschichte ausgetauscht. Unsere Beziehungen sind auch dank der aktiven Zivilgesellschaft robust, eng und nachhaltig geworden. Sie werden heute oft als Musterbeispiel für gute Beziehungen zwischen einem größeren und einem deutlich kleineren Nachbarn präsentiert. Eine Succes Story!
„Es lohnt sich, in die Begegnungen von Menschen zu investieren“
Was muss Ihrer Meinung nach passieren, damit die – trotz aller Fortschritte – zum Teil immer noch vorhandenen Grenzen in den Köpfen der Leute verschwinden?
Ich bin optimistisch – die Grenzen werden langsam aber sicher abgebaut. Ganz wichtig für eine authentische Annäherung ist ein gegenseitiges besseres Kennenlernen. Die vergleichende Meinungsumfrage, die durch den deutsch-tschechischen Zukunftsfonds 2016 in Auftrag gegeben wurde, zeigte deutlich, dass es für die Bildung einer positiven Meinung über das Nachbarland und deren Bevölkerung entscheidend ist, ob man einen Tschechen oder einen Deutschen auch persönlich kennt. Daher lohnt es sich, in die Begegnungen von Menschen zu investieren. Die erwähnte Umfrage hat auch einen künftigen Schwachpunkt offengelegt: Für das Nachbarland und seine Kultur interessieren sich eher ältere Leute. Wir sollten uns daher mehr auf unsere Jugend fokussieren. Es gilt allerdings, dass sich unsere Beziehungen in den letzten Jahren nicht nur zur politischen Normalität, sondern sogar über diese hinaus zu einem nachbarschaftlichen Miteinander entwickelt haben. Die Sprachbarriere ist oft die einzige wirkliche Hürde.
Wie kann diese Sprachbarriere weiter abgebaut werden?

„Ich würde mir sehr wünschen, dass man zumindest im bayerischen und sächsischen Grenzgebiet Tschechisch an den Realschulen als zweite Sprache anbietet – und es nicht als Fremdsprache, sondern als Nachbarsprache wahrnimmt.“ Foto: LRA FRG
Es ist ganz klar, dass Tschechisch eine relativ kleine Sprache bleiben wird und daher werden auch künftig immer mehr Tschechen Deutsch lernen wollen als umgekehrt. Ich würde mir sehr wünschen, dass man zumindest im bayerischen und sächsischen Grenzgebiet Tschechisch an den Realschulen als zweite Sprache anbietet – und es nicht als Fremdsprache, sondern als Nachbarsprache wahrnimmt. Sprachunterricht und -politik sind für den Abbau von Barrieren wichtig, aber es gibt auch andere, ganz praktische Wege, wie man Leute zu Begegnungen und zum Lernen von Sprachen motivieren kann, etwa durch den Ausbau der notwendigen Schnellzugverbindung zwischen unseren Metropolen. Dann können wir gemeinsam von unserer geografischen Nähe und Wirtschaftskompatibilität noch mehr profitieren.
Wie will die tschechische Regierung den Grenzraum „Šumava Nationalpark“ künftig weiter stärken?
Im Moment verlaufen hier parallel mindestens zwei Prozesse. Zum einen geht es um die Festlegung von Gebietszonen, wobei unterschieden wird, welchen Grad des Schutzes die jeweiligen Zonen benötigen. Zum anderen verläuft hier ein langwieriger Prozess der Suche nach nachhaltigen und ökologischen Möglichkeiten der Öffnung bestimmter Gebiete des Nationalparks für die öffentliche Nutzung. Im Vergleich zum Bayerischen Wald gibt es auf dem Territorium des Šumava-Nationalparks deutlich mehr Gemeinden – und somit gibt es auf der tschechischen Seite auch mehr gegenläufige und sich konkurrierende Interessen, die man austragen muss. Erfreulich ist jedenfalls, dass sich in den letzten sechs bis sieben Jahren die Zusammenarbeit mit der bayerischen Seite deutlich intensiviert hat. Im vergangenen Jahr hat sogar der tschechische Direktor des Nationalparks, Pavel Hubený, eine hohe Anerkennung in Form der Umwelt-Medaille vom bayerischen Staatsminister erhalten.
„Quoten werden nicht als nachhaltig wahrgenommen“
Der neue Ministerpräsident Andrej Babiš wird seitens westlicher EU-Staaten eher kritisch betrachtet, gerade wenn es um die Frage der Flüchtlingsaufnahme innerhalb Europas geht. Wie sehen Sie das?
Die Frage der Flüchtlingsquoten, zu denen die EU-Mitgliedstaaten aufgrund einer Mehrheitsentscheidung in der EU verpflichtet wurden, wurde nicht nur in den Visegrád-Staaten Tschechien, Slowakei, Polen und Ungarn skeptisch wahrgenommen. Schrittweise haben auch andere Länder – inklusive Österreich – das System als nicht funktionsfähig bezeichnet. Die tschechische Politik hat von Anfang an auf die notwendige Nachhaltigkeit der Lösungsvorschläge aufmerksam gemacht. Quoten werden in meinem Land nicht als nachhaltig wahrgenommen. Der Grund ist ganz einfach: Die Asylsuchenden wollen nicht in Tschechien bleiben. Die Flüchtlinge, die in Tschechien aufgenommen wurden, sind bei der ersten Gelegenheit nach Deutschland und Skandinavien weitergegangen.

Generalkonsulin Kristina Larischovà mit Tschechiens Ministerpräsidenten Andrej Babiš bei einem Besuch im Siemens-Werk in Bamber. Foto: Larischovà
Es ist seit dem Höhepunkt der Migrationskrise im Jahr 2015 viel Zeit vergangen, man hat heute einen viel realistischeren Blick und die öffentliche Debatte in Deutschland hat sich – auch dank der bayerischen Auseinandersetzung mit dem Thema – deutlich verändert. Heute wird der anfängliche Ansatz der Visegrád-Staaten, dass man die Ursachen in den Quellenländern bekämpfen und der Migration vorbeugen muss, allgemein akzeptiert. Am 7. Februar dieses Jahres haben sich die Regierungschefs der Visegrád-Gruppe mit Bundeskanzlerin Merkel in Bratislava getroffen und ein gemeinsames Entwicklungsprojekt zur Bekämpfung von Fluchtursachen in Marokko, einem der Hauptherkunftsländer der massiven Migrationsbewegung, verkündet.
Sieht sich Tschechien als Teil der Visegrád-Staaten als eine Art Gegengewicht zur Europäischen Union? Oder wie ist hier die Selbstwahrnehmung?
Tschechien sieht sich als fester Bestandteil Europas, mit einer starken zentraleuropäischen Identität. Zu der gehört auch die Zugehörigkeit zur Gruppe der Visegrád-Staaten. Visegrád sollte auf keinen Fall ein Gegengewicht zur EU darstellen. Visegrád ist 1991 deswegen entstanden, damit die künftigen EU-Antragsteller die Fähigkeit zeigen, zusammen zu kooperieren und zum Zusammenhalt der EU beizutragen. Diese Länder werden nicht immer – aber oft – durch gemeinsame Interessen verbunden, die sie dann gemeinsam auf dem europäischen Parkett vertreten. Tschechien wird Mitte dieses Jahres den Visegrád-Vorsitz von der Slowakei übernehmen – und ich bin mir sicher, dass man sich auf ein positives und konstruktives Programm konzentrieren will. Es ist wichtig, den Zusammenhalt der EU zu stärken – insbesondere mit Rücksicht auf den Brexit und die gemeinsame Asylpolitik der EU, die man dringend braucht.
„2018 hat sich die Wohlstandsschere weiter geschlossen“
Wie betrachten Sie die derzeitige Entwicklung der tschechischen Wirtschaft im Allgemeinen?
Im vergangenen Jahr hat das Wirtschaftswachstum 3,0 Prozent erreicht, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Prozent darstellte. Am meisten haben zum tschechischen Wachstum die steigende einheimische Nachfrage sowie die Investitionen im Unternehmenssektor beigetragen. Das reale Einkommen der Bevölkerung ist gestiegen. In diesem Jahr kann man laut Prognosen auf ein BIP-Wachstum in Höhe von 2,7 Prozent hoffen – auch eine solide Aussicht.

„Das heißt, dass es zu einer realen Konvergenz kommt – und der Wohlstand zunimmt.“ Foto: pixabay.com/ AhmadArdity
Laut Statistiken hat Tschechien im letzten Jahr beim Pro-Kopf-BIP (umgerechnet nach der Kaufkraftparität) 91 Prozent des EU-Durchschnitts erreicht – und somit die Spitzenposition unter den mittel- und osteuropäischen Staaten verteidigt. Um sich das Niveau vorstellen zu können: Spanien liegt im Moment um einen Prozentpunkt höher als Tschechien. Das heißt, dass es zu einer realen Konvergenz kommt – und der Wohlstand zunimmt. Es gibt aber auch Schattenseiten des Erfolgs: Im vergangenen Jahr hat Tschechien die niedrigste Arbeitslosenquote innerhalb der EU in Höhe von 2,2 Prozent verzeichnet – den niedrigsten Wert seit 20 Jahren. Dies kann man primär als erfreulich betrachten, die andere Seite der Medaille offenbart jedoch die Tatsache, dass die Wirtschaft unter einem Fachkräftemangel leidet. Auch hier gibt es Ähnlichkeiten mit Deutschland und Bayern.
Trotzdem haben nicht alle vom Aufschwung profitiert: Es gibt die Mächtigen und Reichen auf der einen Seite. Andererseits wächst aber auch die Armut. Wie kann Tschechien dem entgegen steuern?
Tschechien ist laut des neuesten Berichtes der Europäischen Kommission und laut Eurostat-Angaben – basierend auf den Daten für das Jahr 2017 – das EU-Land mit den geringsten Einkommensunterschieden. Die Einnahmen des Fünftels der reichsten Tschechen sind 3,4-mal höher als die Einnahmen des ärmsten Fünftels der Bevölkerung. Der EU-Durchschnitt bewegt sich dabei um das Fünffache.
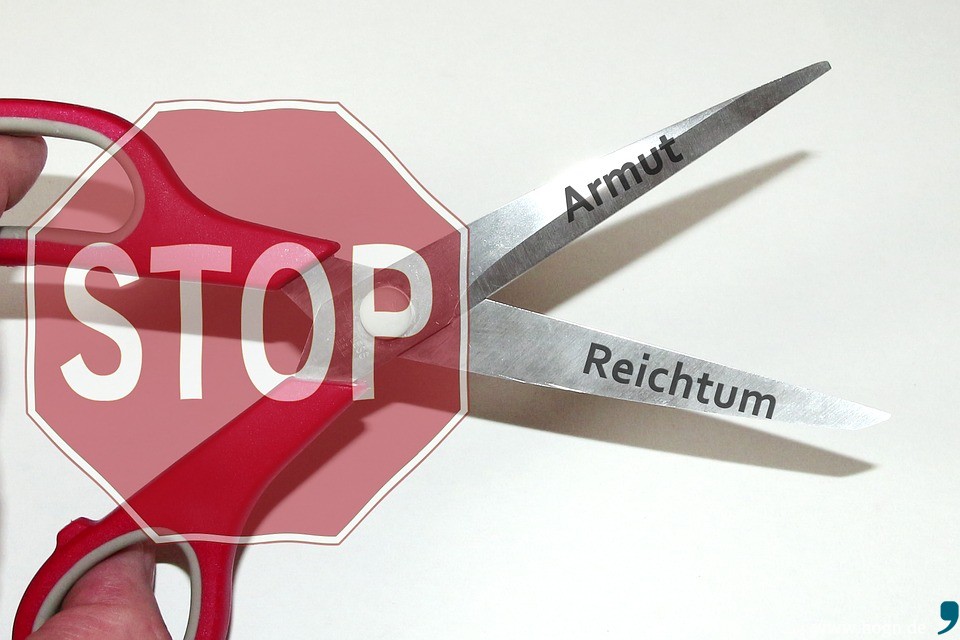
„Tschechien hat eine Tradition der relativ nivellierten Einkommenspolitik.“ Foto: pixabay.com/Buecherwurm_65
Es gibt in Tschechien zwölf Prozent armutsbedrohte und sozial ausgrenzte Bürger. Es war der niedrigste Anteil in der gesamten EU, wo der Durchschnitt bei 22 Prozent lag. Im letzten Jahr hat sich die Wohlstandsschere mit der zurückgehenden Arbeitslosigkeit und der Steigerung des Minimallohnes etwas weiter geschlossen. Tschechien hat eine Tradition der relativ nivellierten Einkommenspolitik.
Kritiker machen allerdings auf die Tatsache des starken regionalen Ungleichgewichtes aufmerksam sowie auf die schlechten Aufstiegschancen für Kinder von niedrigqualifizierten und einkommensschwachen Eltern. Wie eben geschildert, steht beim Thema soziale Gerechtigkeit Tschechien nicht schlecht da. Sie haben allerdings Recht, wenn Sie das Thema des Zusammenhaltes der europäischen Gesellschaften ansprechen. Das Wohlstandsgefälle innerhalb der Gesellschaft – nicht nur unter den einzelnen EU-Mitgliedstaaten – ist meines Erachtens ein der wichtigsten Gründe für den britischen Volksentscheid zum EU-Austritt gewesen.
Beim „harten Brexit“: Wegfall von rund 40.000 Arbeitsstellen
Welche Konsequenzen wird der bevorstehende Brexit für den tschechischen Wirtschaftsraum mit sich bringen?
Nicht nur, dass die EU plötzlich einen wichtigen Netto-Zahler weniger haben wird – Tschechien ist in der kommenden Haushaltsperiode noch ein Netto-Empfänger, aber nicht mehr lange. Der Brexit bedeutet ein jährliches Minus auf der Aufnahmeseite des EU-Budgets in Höhe von 13 Milliarden Euro, was etwa – gemessen am Ausmaß des jetzigen Finanzrahmens für die Jahre 2014 bis 2020 – acht Prozent darstellt. Wie schon gesagt, ist unsere Wirtschaft vom Außenhandel abhängig und Großbritannien gehört zu unseren wichtigen Handelspartnern. Sollte es schließlich zum sog. harten oder No-deal-Brexit kommen, würden nach Schätzungen unsere Exporte nach Großbritannien um 20 Prozent sinken, was zu einem Rückgang des BIP um 1,1 Prozent führen würde. Dies würde einem Minus in Höhe von 40.000 Arbeitsstellen entsprechen. Also, sehr schmerzhaft! Sollte es einen Brexit mit Vertrag oder Übergangsregelungen geben, würde der BIP-Rückgang „nur“ 0,3 Prozent betragen. Auch dies würde aber den Arbeitsmarkt etwa 10.000 Arbeitsplätze kosten.

„Der Brexit bedeutet ein jährliches Minus auf der Aufnahmeseite des EU-Budgets in Höhe von 13 Milliarden Euro.“ Foto: pixabay.com/ Foto-Rabe
Darüber hinaus wird es mit dem Brexit unausweichlich zur Stärkung der Stimme der Eurozone kommen. Sehr viele Entscheidungen, die die wirtschaftlichen Angelegenheiten betreffen, werden innerhalb der EWU getroffen. Großbritannien ist momentan der größte außenstehende Staat. In der Gegenwart werden mehr als 70 Prozent des BIP der EU in der EWU produziert, nach dem Brexit wird sich dieser Anteil auf die 86 Prozent des BIP erhöhen. Außerhalb der Eurozone werden dann bleiben: Polen, Tschechien, Schweden, Dänemark, Rumänien, Ungarn, Bulgarien und Kroatien. Schon jetzt erfüllt die Eurozone die sog. qualifizierte Mehrheit bei der EU-Abstimmung: Die 19 Länder der EWU stellen 67 Prozet der EU-Bevölkerung dar. Deshalb steht unsere Politik und Gesellschaft vor einer strategischen Frage des EWU-Beitritts. Es ist nicht im Interesse meines Landes, dass in Europa neue Trennlinien mit einem Kern und Peripherien entstehen.
Wie sehr wünschen sich die Tschechen die Einführung des Euros?
Wir haben uns im EU-Beitrittsvertrag zum EWU-Beitritt verpflichtet. Für den EWU-Beitritt müssen die sog. Maastrichter Kriterien erfüllt werden. Es geht um die Kriterien der Preisstabilität (Inflation), Zustand der öffentlichen Finanzen (Verschuldung), Konvergenz der Zinsen und schließlich die mindestens zwei Jahre lange Teilnahme am europäischen Mechanismus der Wechselkurse, dem sog. ERM II.
Es stimmt, dass Tschechien seit 2013 die Verschuldungskriterien erfüllt. Es erfüllt auch die anderen Kriterien locker – bis auf die Teilnahme am ERM II, die formell nicht erfüllt wird. Das heißt: Der Kurs der tschechischen Krone wird nicht zentral paritätisch festgeschrieben. Im Moment gibt es allerdings keine große Eile der Eurozone beizutreten. Warum? Tschechien hat eine sehr offene Gestaltung der Wirtschaft, es nimmt stark an der internationalen Arbeitsteilung teil. Daher ist uns die Festlegung des Wechselkurses sehr wichtig.
„Man rechnet fest mit dem EWU-Beitritt – jedoch nicht kurzfristig“
Es wird befürchtet, dass die Einführung des Euro unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt beeinträchtigen könnte. Darüber hinaus haben Leute einfach Angst, dass mit dem Euro eine Preissteigerung einhergeht. Hinzu kommt, dass viele Politiker und Wirtschaftswissenschaftler auch die Art und Weise, wie man die sog. Eurokrise zu bewältigen versucht hatte, eher skeptisch betrachten. Man rechnet fest mit dem Beitritt zur EWU – jedoch nicht kurzfristig.
Haben Sie recht herzlichen Dank für Ihre Zeit und die Beantwortung unserer Fragen. Ihnen weiterhin alles Gute.
Die Fragen stellte: Stephan Hörhammer