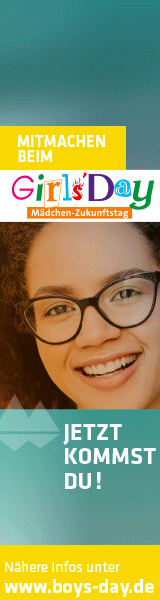Allen Theorien über Filterblasen zum Trotz haben Soziale Medien etwas an sich, das wir aus der „realen“ Welt so nicht kennen: Öfter als gewohnt kommen wir hier mit Meinungen in Berührung, die nicht der eigenen entsprechen. Wenn etwa die Werbung einer Partei in meinem Newsfeed landet, mit der ich so gar nicht kann. Wenn mir ein Zeitungsartikel vorgeschlagen wird, der nicht meinen Standpunkt vertritt. Oder wenn meiner Meinung in der Kommentarleiste widersprochen wird. Das alles ist grundsätzlich etwas sehr Gesundes, denn: Debatten, Konflikte und Streit bereichern den Diskurs, können dazu beitragen über die eigene Perspektive nachzudenken, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken. Doch jeder, der sich regelmäßig in Sozialen Medien aufhält, weiß, dass das oftmals nicht mehr als ein Wunschdenken ist.

Nicht immer steht am Ende eines Streits auch ein Kompromiss. Foto: pixabay/hbieser
Im absoluten Idealfall endet eine lebendige Debatte mit einem Kompromiss. Das ist oftmals nicht der Fall – muss es auch nicht, wäre aber zumindest wünschenswert. Jeder bringt seine Argumente vor, zeigt die Schwächen des jeweils anderen auf – und einigt sich am Ende auf eine gemeinsame Position. Idealtypisch wird aus „A“ gegen „B“ einfach „C“. Ein Schema, das sich unlängst – dank prominenter Unterstützer – immer größerer Beliebtheit erfreut, ist jedoch das Folgende: Dem Argument „A“ wird Argument „Y“ entgegengehalten – und das Ergebnis lautet „17“.
Aber, aber, Jesus…!
Der Versuch, Argumente mit einem „Aber, was ist eigentlich mit…?“ zu entkräften, war schon im Kalten Krieg eine beliebte Taktik der Sowjetunion, sich Kritik aus dem Westen vom Leib zu halten. Der Journalist Edward Lucas beschrieb dieses Phänomen 2008 in einem Beitrag im britischen „Economist“ als Whataboutism. In der Logik dieses rhetorischen Kniffs soll ein Einwand entkräftet werden, indem ein Argument vorgebracht wird, das dem eigentlichen Thema bestenfalls ähnlich ist. Wird Russland für die völkerrechtswidrige Annexion der Krim kritisiert, lautet das Gegenargument in der Logik des Whataboutism: „Aber was bitte hat denn die USA in Afghanistan aufgeführt? War das nicht viel schlimmer?“
Es wäre wohl überzogen zu sagen, Jesus ist der Urheber des Whataboutism, aber selbst in der Bibel kommen derlei Kniffe vor: Als man ihm eine Ehebrecherin vorführte, verkündete er: „Wer von euch frei von Schuld ist, der werfe den ersten Stein.“ Und noch heute liefert jede x-beliebige Talkshow unzählige, sehr anschauliche Beispiele dafür – das Ende der Debatte, bevor sie überhaupt begonnen hat.
Seit Donald Trump im Weißen Haus die Fäden spinnt, erlebt der Whataboutism eine neue Blütezeit. Das bequeme am Whataboutism ist, dass man sich die lästige Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Argument erspart. Durch den bloßen Verweis auf einen anderen Bestand soll die eigene Weste reingewaschen werden bzw. rein bleiben. Wer auf die imperialistische Politik der USA verweist, erspart sich die mühselige Arbeit, die Annexion der Krim wirklich beurteilen zu müssen. Das funktioniert übrigens nicht nur in der Politik, sondern auch im Privat-Alltag: „Hast du etwa schon wieder keine Milch gekauft?“ – „Du hast das Bad letzte Woche doch auch nicht geputzt!“
Kommen wir nun zum eigentlichen Fall: Auch beim Hog’n wird erfreulicherweise zahlreich und oftmals sehr leidenschaftlich diskutiert. In vielen Fällen sind diese Diskussionen fruchtbar, in anderen Fällen folgt auf „A“ ein „Y“ und darauf „17“. Wenn – um es ganz konkret zu machen, obwohl das auf eine Vielzahl von Beiträgen zutrifft – etwa der AfD-Landtagsabgeordnete Ralf Stadler kritisiert wird, sich regelmäßig in einer Art und Weise zu äußern, die – nach Meinung des kritisierenden Autors – einer demokratischen Institution nicht angemessen ist, spielt es keine Rolle, dass es anderswo in Deutschland linksextremistische Gewalt gibt. Der Verweis auf Patzer der Anderen mag nützlich sein, um sich nicht mit der eigentlichen Causa auseinandersetzen zu müssen, ist aber kein Argument. Die eine Tat wird nicht dadurch besser, dass es anderswo auch eine Ähnliche oder eine noch Schlimmere gab bzw. gibt.
Senf mit Ketchup – und kein Durchblick
Die Liste der Beispiele und Wendungen dieses rhetorischen Ping-Pongs ist lang: Stehen deutsche Diesel-Fahrverbote im Raum, dauert’s in der Regel nicht lange bis jemand „Aber China…!“ brüllt. Werden zu niedrige Sozialleistungen beanstandet, folgt nicht selten die Aussage: „Aber in Griechenland sind sie noch viel geringer!“ Und wenn ein AfD-Agitator, dem es beim Wort „Feminismus“ sämtliche Haare zu Berge stellt, beim Thema „Islam“ plötzlich „Aber, die Frauen…!“ ruft, ist es auch dasselbe. Selbst am Tag nach der Reichspogromnacht titelte die Volkszeitung: „Londoner Hetze wegen Glasscherben – aber kein Wort über zerstörte Araberdörfer in Palästina!“
Was am Ende dieses Hin-und-Her, dieses „Du-bist-Schuld-Nein-Du!“ zurückbleibt, ist ein heilloses Durcheinander, ein Verwischen von Fakten und Meinungen, Senf mit Ketchup, bei dem am Ende keiner mehr den Durchblick hat – und jede konstruktive Debatte erstickt.
Aber, aber, … Nazi!
Ein ganz ähnliches Muster lässt sich übrigens auch bei diversen Betitelungen und Zuschreibungen des jeweiligen Gegenübers erkennen. Den Einwand, zu viele Flüchtlinge könnten für Deutschland schwierig zu verkraften sein, mit einem „Aber, Nazi!“ zu kontern, hilft allen Beteiligten nur sehr wenig. Und die Forderung für mehr finanzielle Umverteilung wird auch nicht durch den Verweis auf den Stalinismus und auf Gulags entkräftet. Der einzige Zweck einer solcher Zuschreibung ist es, den Urheber des Arguments zu diskreditieren, die Debatte zu beenden – ohne auf den eigentlichen Kern der Sache eingehen zu müssen.
Es mag dahingestellt sein, ob Soziale Medien tatsächlich der Ort sind, um eine geordnete Debattenkultur zu fordern. Aber faktisch ist es nun mal der Ort, an dem derzeit die meisten Debatten geführt werden – und der Ort, an dem wir am zahlreichsten mit anderen Meinungen konfrontiert werden. Abseits des Affenkäfig-Charakters kann man derlei Plattformen auch als Chance sehen – als Chance, um sich mit Menschen und Meinungen auseinanderzusetzen, mit denen man im „realen“ Leben selten bis nie konfrontiert wird. Als Chance, seinen Horizont zu erweitern, Argumente zu schärfen, vielleicht sogar, um gesellschaftliche Gräben zu überwinden. Die Algorithmen und Vermarktungslogiken dieser Plattformen sprechen nicht gerade für eine solche Entwicklung, aber man kann immer noch versuchen, das Beste daraus zu machen…
Johannes Gress