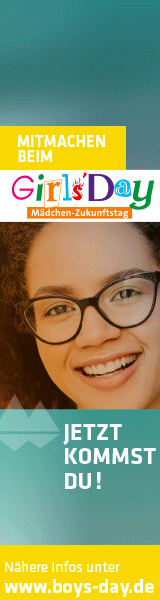Katowice. Zwei Wochen lang tagten Vertreterinnen und Vertreter von 196 Staaten im polnischen Katowice, um über die Zukunft des Klimas zu entscheiden. Erreicht habe man einen „Minimalkonsens“: ein den Umständen entsprechend guter Deal. Und: ein den Umständen entsprechend schlechter Deal. Erstere „Umstände“ betreffen die Rahmenbedingungen der COP24: Dass sich über 190 Staaten – darunter die USA, China und Indien – auf ein gemeinsames Regelwerk zur Umsetzung des Pariser Abkommens einigen können, ist definitiv ein beachtliches Zeichen. Letztere „Umstände“ betreffen die klimatischen Rahmenbedingungen. Hier zeigt sich: Will man der Erderhitzung ernsthaft etwas entgegensetzen, braucht es deutlich mehr Engagement als sich in dem 133-seitigen „Regelbuch“ wiederfindet.

Ende gut, alles gut? Nach zähen Verhandlungen durfte COP24-Präsident Michal Kurtyka dann doch den Hammer schwingen. Jedoch nicht zur Freude aller. Foto: cop24.gov.pl
Die Beschlüsse im Überblick
Trotz einiger „Sorgenkinder“, allen voran die ölexportierenden Staaten USA, Saudi Arabien, Kuwait und Russland, konnte man sich auf der Konferenz von Katowice auf ein gemeinsames „Regelbuch“ einigen. Dieses beinhaltet einheitliche Transparenzregeln für alle Staaten. Ab 2024 müssen die 196 Nationen nach festgelegten Kriterien regelmäßig über ihre Fortschritte und Maßnahmen in Sachen Klimaschutz Bericht erstatten. Dieses „scharfe Schwert der Transparenz“ soll die Staatenwelt dazu verpflichten, die im Pariser Abkommen vereinbarten Klimaziele einzuhalten. Konkrete Sanktionsmechanismen sind jedoch nicht vorgesehen – hier baue man auf den Druck seitens der Zivilgesellschaft. Dass hier auch China, Indien und Brasilien miteingebunden sind, ist durchaus als Erfolg zu werten.
Nach langem Hin und Her – auch hier standen erneut die USA, Russland, Kuwait und Saudi Arabien auf der Bremse – konnte man sich auf die Formulierung einigen, dass man die „rechtzeitige Fertigstellung des IPCC-Berichtes zum 1,5-Grad-Ziel begrüßt“. Das ist nicht mehr als ein äußerst schwaches Lippenbekenntnis. Der Sonderbericht wurde im Oktober veröffentlicht und mahnt zu einer Abkehr vom bisherigen 2-Grad-Ziel – zugunsten einer Reduktion des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad. Die sogenannte High-Ambition-Coalition, zu der sich neben Deutschland insgesamt 103 Nationen zusammenfanden, erklärte, „für das 1,5-Grad-Ziel zu kämpfen“.
Auch in Sachen finanzieller Unterstützung konnten Fortschritte erzielt werden: Ab 2020 sollen laut dem verabschiedeten „Regelbuch“ jährlich 100 Milliarden Dollar in den Umweltschutz fließen. Dieses Abkommen gilt bis 2025, in der Zwischenzeit soll aber bereits eine Verlängerung über 2025 hinaus verhandelt werden. Die Krux an der Vereinbarung: In die jährlich 100 Milliarden Dollar sollen nicht nur Unterstützungsleistungen, sondern auch gewöhnliche Kredite miteinberechnet werden.
Die COP24 – ein Erfolg?
Auf diplomatischer Ebene ist das Abkommen durchaus als Erfolg zu werten. Dass es in einer zunehmenden Nationalisierung der Staatenwelt überhaupt zu einem Abkommen gekommen ist, kann schon als Erfolg betrachtet werden. Manche Beobachter bewerten das 133-seitige Druckwerk schon deshalb positiv, da es immerhin zu keiner Verschlechterung im Vergleich zum Pariser Abkommen von 2015 gekommen sei. Mit Regierungschefs wie Donald Trump oder dem Brasilianer Jair Bolsonaro, die den Klimawandel bereits mehrmals öffentlich in Zweifel zogen, war dies nicht von Vornherein gegeben. Positiv zu werten ist auch der Umstand, dass man die sehr bevölkerungsreichen und wirtschaftlich schnell wachsenden Länder Indien und China mit an Bord bringen konnte.

Deutlich mehr Anstrengungen hätte sich der Abgeordnete der Europäischen Grünen, Thomas Waitz, erwartet. Foto: Grüne/Waitz
Insgesamt ist es ein Abkommen vieler großer Worte. Was dann konkret daraus folgt, steht auf einem anderen Blatt. Angesichts der Entwicklungen des globalen Klimas in jüngster Vergangenheit fordern viele Experten eine deutliche ambitioniertere Herangehensweise. Thomas Waitz, Mitglied der Grünen/EFA-Fraktion im Europäischen Parlament und in Katowice vor Ort, bemängelt, dass die EU deutlich mehr Engagement hätte zeigen müssen. Seiner Meinung nach hätte sich „die Europäische Union an die Spitze der Klimaschutzanstrengungen stellen müssen“.
„Viele Regierungen haben noch immer nicht verstanden, dass die Klimakrise nicht mit Minimalkompromissen und nationalen Sonderwünschen gestoppt werden kann“, kritisiert auch WWF-Klimaexpertin Lisa Plattner. In vielen Fragen, so Plattner, sei das Abkommen „ambitionslos“. Und weiter: „Fossile Blockierer sollten endlich einsehen, dass unsere Zukunft auf dem Spiel steht, wenn die Erderhitzung nicht eingedämmt werden kann.“
Trotz „einiger Sabotageversuche aus dem Weißen Haus, von Saudi-Arabien und Brasilien“ habe man eine 196 Staaten umfassende Übereinkunft erzielt – ein Erfolg, findet Christoph Bals, politischer Geschäftsführer der Umweltorganisation Germanwatch. „Ohne den Widerstand der USA und Saudi-Arabiens“ seien jedoch eindeutig ambitioniertere Schritte möglich gewesen, analysiert Bals.
Ich bin sehr stolz auf das hervorragende Verhandlungsteam des @bmu . Vielen Dank an alle! #COP24 https://t.co/nKHOIi5oQk
— Svenja Schulze (@SvenjaSchulze68) December 15, 2018
„Sehr stolz“ hingegen sei man auf das Abkommen auf Seiten des Bundesumweltministeriums, wie Ministerin Svenja Schulze nach dem Beschluss via Twitter verlautbarte. „Mein Wunsch zu Weihnachten war ein Regelbuch, das habe ich bekommen“, erklärt Schulze. „Zum ersten Mal“, äußerte sich die Bundesumweltministerin am Rande der COP24, „lässt sich beim Klimaschutz nicht nur die halbe, sondern die ganze Welt in die Karten schauen“.
Speziell Deutschland, das im Zuge der Konferenz mit dem Schmähpreis „Fossil des Tages“ ausgezeichnet wurde, müsse hier jedoch vor allem in Sachen Verkehrswende deutlich nachlegen, stellt Germanwatch-Geschäftsführer Bals klar. Unverzichtbar sei auch ein möglichst rascher Kohleausstieg. Einen entsprechenden Ausstiegspfad soll Anfang des Jahres eine Kohlekommission aushandeln.
Auch UN-Generalsekretär António Guterres macht deutlich, dass das COP24-Abkommen lediglich der Grundstein für weitere Verhandlungen sein könne. Auch hier müsse in naher Zukunft noch nachgeschärft werden. Hierzu verweist Guterres auf eine weitere UN-Klimakonferenz in Chile, die nächsten September stattfinden soll.
Reichen die Beschlüsse für das 2-Grad-Ziel?
Auch wenn der IPCC-Sonderbericht eindrücklich davor warnt, eine Erhöhung des globalen Temperaturanstiegs auf mehr als 1,5 Grad zu riskieren, ging es in Katowice vordergründig um das Pariser Abkommen aus dem Jahr 2015. Dort hatte man sich darauf verständigt, den Anstieg auf „deutlich unter zwei Grad Celsius“ zu beschränken und „Anstrengungen in Richtung 1,5 Grad zu unternehmen“. Bei der COP24 in Katowice ging es nun darum, ein konkretes Regelwerk in diese Richtung zu entwerfen – im Optimalfall sollten die Anstrengungen der Staatengemeinde dann deutlich Richtung 1,5 Grad gehen.

„Auf welcher Seite seid ihr?“, fragen Aktivisten am Rande der COP24. Vor allem Umweltschutzorganisationen fordern deutlich schärfere Reglementierungen. Foto: cop24.gov.pl
„Das 1,5-Grad-Ziel“, so erklärt Martin Krenn von der Allianz für Klimagerechtigkeit, „ist heute noch viel notwendiger als noch vor drei Jahren angenommen“. Eine entsprechende Nachjustierung im Regelbuch von Katowice – so wie vielfach gefordert – habe man jedoch nicht erreichen können. „Das Regelbuch per se“ enthalte dabei „keine konkreten Zielvorgaben“, wie Krenn auf Hog’n-Nachfrage erklärt. Man sei zwar äußerst motiviert in die ersten Tage der Konferenz gegangen, berichtet Krenn, der die gesamten zwei Wochen über vor Ort war. Schon nach wenigen Tagen habe sich jedoch herausgestellt, dass keine entsprechende technische Grundlage geschaffen werden könne. Nehme man derzeit alle nationalen Klimastrategien einzeln zusammen, komme man auf ein Plus von drei Grad. Ob das verabschiedete Regelbuch also überhaupt für das 2-Grad-Ziel reiche, sei alles andere als gesichert. Die Zeit, so viel steht fest, drängt.
„Leider gibt es in aller Regel – den Sicherheitsrat ausgenommen – bei UN-Abkommen keine Sanktionen“, erklärt Krenn weiter. Dass die einzelnen Staaten aber ab 2024 rechenschaftspflichtig seien, könne durchaus wirksam erscheinen – schließlich wolle kein Staat „auf internationaler Ebene das Gesicht verlieren“.
Die Zivilgesellschaft ist gefordert
Hohe Ansprüche stellt man nun vor allem an die Zivilgesellschaft, denn: Es sollen zivilgesellschaftliche Organisationen sein, die mithilfe des „scharfen Schwerts der Transparenz“ für eine Einhaltung der Beschlüsse sorgen. Ganz besonders UN-Generalsekretär Guterres appelliert an die „civil society“ dieses Anliegen voranzutreiben – und „all‘ ihre Kraft“ zu nutzen, um den Klimawandel im Zaum zu halten.
I expect civil society and young people to hold leaders accountable for meaningful #ClimateAction. I told them today at #COP24 to use all the powers at their disposal and not to give up.
— António Guterres (@antonioguterres) December 14, 2018
Dass zivilgesellschaftliches Engagement alleine ausreiche, um Staaten zu disziplinieren, ist jedoch mit einer gewissen Skepsis zu betrachten. Wie in der Vergangenheit mischen in dieser Causa jede Menge weiterer Interessenvertreter mit. Vor allem diverse Wirtschaftsverbände sowie jene Industrienzweige, deren Wirtschaftlichkeit von fossilen Energieträgern abhängt, dürften eher wenig Interesse an gewissen Maßnahmen haben. Mittlerweile hätte jedoch auch „ein guter Teil der Unternehmen erkannt, dass Umweltschutz auch aus wirtschaftlicher Sicht interessant“ sein könne, findet Martin Krenn von der Allianz für Klimagerechtigkeit. Am offensichtlichsten zeige sich dies in der Landwirtschaft, die in jüngster Vergangenheit vermehrt unter Dürre oder Starkniederschlägen zu leiden hatte.
Zudem seien NGOs und zivilgesellschaftliche Organisationen nicht die einzigen Korrekteure, wenn es ums Thema Klimawandel geht. Mittlerweile seien Umweltschutz und Klimawandel ebenfalls tief im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert, erklärt Krenn. Nicht zuletzt hätten viele Menschen am COP24-Abschlusstag realisiert, dass es um „die Zukunft ihrer Kinder“ gehe. Dennoch dürfe das Thema Klimaschutz nicht nur auf das Individuum abgewälzt werden – „es braucht auch einen politischen Rahmen“. All‘ zu viel Zeit, um diesen zu verhandeln, bleibt dabei nicht mehr.
Johannes Gress