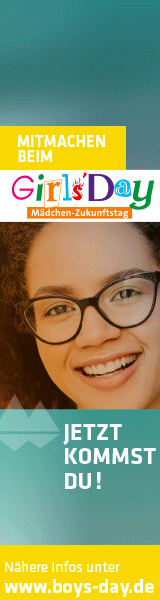Exakt 16,1 Kilometer sind es von der Freyunger Hog’n Redaktion bis zur Grenze ins tschechische Nachbarland. Einst verlief hier ein „Eiserner Vorhang“, die Grenze zwischen „Ost“ und „West“, zwischen Kommunismus und Kapitalismus, zwischen Spreewald-Gurken und Coca-Cola. Heute, auf den Tag genau 28 Jahre nach dem Fall der Mauer, ist vom einstigen „Todesstreifen“, der die beiden Systeme trennte, kaum mehr als ein Hauch Nostalgie übrig. Seit der Osterweiterung 2004 ist Tschechien Mitglied der Europäischen Union, aus Zäunen, Stacheldraht und Eisernen Vorhang wurden ein paar Grenzhäuschen, die höchstens noch symbolisch an eine Trennung erinnern.
Mit dem 9. November 1989 wurde nicht nur der Kollaps des sowjetischen Systems eingeleitet, sondern auch der vermeintliche Siegeszug von Kapitalismus und Demokratie. Der unausweichliche Sieg des demokratischen Liberalismus habe hiermit das „Ende der Geschichte“ eingeleitet, frohlockte US-Politikwissenschafter Francis Fukuyama in seinem gleichnamigen Bestseller. Dem ewigen Streit der beiden Systeme sei damit ein für alle Mal ein Ende bereitet, die Demokratie nach westlichem Vorbild auf ewig Sieger. Am 20. und 21. Oktober 2017 wurde in Tschechien ein neues Parlament gewählt – spätestens jetzt ist klar: Diese „Geschichte“ wird noch um ein paar Kapitel länger…
Was wurde gewählt?
Am 20. und 21. Oktober waren rund 8,4 Millionen Tschechinnen und Tschechen aufgerufen an die Urne zu gehen. Gewählt wurde ein neues Parlament, genauer gesagt das 200 Sitze starke Abgeordnetenhaus, die neben dem Senat zweite und mächtigere Kammer im tschechischen Parlament. Ähnlich wie in Deutschland und den meisten europäischen Ländern wird bei unseren östlichen Nachbarn nach dem Verhältniswahlsystem gewählt, was zur Folge hat, dass keine absolute Mehrheit (wie beispielsweise in den USA oder Großbritannien) nötig ist, um einen Regierungsauftrag zu erhalten. Ebenso gilt eine Sperrklausel von fünf Prozent, welche eine Partei oder Liste erreichen muss, um ins Parlament einziehen zu können. Genauso wie im bundesdeutschen System dauert eine Legislaturperiode vier Jahre, das letzte Mal wurde also im Jahr 2013 ein neues Abgeordnetenhaus gewählt.
Für Aufsehen sorgte das Ergebnis der Parlamentswahlen gleich aus mehreren Gründen. Zwar sind sogenannte „Anti-System-Parteien“ in Europa mittlerweile kein Novum mehr. Dass eine politische Landschaft in Folge eines Urnengangs jedoch derart zerrüttet wird wie am jüngsten Wahltag in Tschechien, betrachten Kritiker im In- und Ausland jedoch mit Sorge. Insbesondere Andrej Babiš, Gründer und Spitzenkandidat der stimmenstärksten Liste ANO 2011 (tschechisch „JA“ und zugleich das Akronym für „Aktion unzufriedener Bürger“) sorgt in Teilen der Bevölkerung für Unmut. Der Milliardär und Großunternehmer kontrolliert nicht nur große Teile der Medienlandschaft, sondern wurde erst kürzlich wegen Verdacht auf Betrug seines Amtes als Finanzminister enthoben. Vielfach betitelte man Babiš deshalb bereits als „tschechischen Donald Trump“.
Das Wahlergebnis
Aber der Reihe nach. Mit einem Zugewinn von rund elf Prozentpunkten gegenüber 2013 konnte Babiš‘ Partei mit 29,64 Prozent der Stimmen 78 der 200 Mandate für sich reklamieren (offizielles Wahlergebnis siehe hier). Zweitstärkste Kraft wurde die liberal-konservative „Demokratische Bürgerpartei (ODS)“ mit 11,32 Prozent. Neben der „Tschechischen Sozialdemokratischen Partei (ČSSD)“ dominierte die ODS das Abgeordnetenhaus seit den 1990ern. Von 1993 bis 1998, von 2006 bis 2009 und von 2010 bis 2013 stellte sie den Ministerpräsidenten – ehe sie vor vier Jahren auf Rang fünf abstürzte. Mit 10,79 Prozent, also nur knapp hinter der ODS, rangiert die Piratenpartei auf dem dritten Platz. Ein Blick ins Parteiprogramm der Piraten verrät außer ein paar vagen Formulierungen in Bezug auf die Freiheit im Netz und die Legalisierung von Cannabis reichlich wenig. Profilieren konnte man sich vor allem als Partei, die gegen das System agiert und schaffte mit einem Zugewinn von über acht Prozentpunkten das erste Mal in der Parteigeschichte den Einzug ins tschechische Parlament.
Auch die rechtsradikale „Freiheit und direkte Demokratie (SPD)“ rund um den tschechisch-japanischen Unternehmer Tomio Okamura sicherte sich mit 10,64 Prozent 22 der 200 Abgeordnetensitze. Aufgefallen war Okamura insbesondere ob seiner strittigen Äußerungen zum Thema Flüchtlinge. Diese seien nach Meinung des Unternehmers „Parasiten“, den Islam setzt er per se mit „Terrorismus“ gleich. Bereits 2014 brachte sich der SPD-Kandidat in die Bredouille, nachdem er Zweifel am Konzentrationslager Lety bei Pisek äußerte und zum „Boykott von Muslimen“ aufrief. Am anderen Ende des politischen Spektrums – aber nicht weniger systemkritisch – schaffte die „Kommunistische Partei Böhmens und Mährens (KSČM)„ mit 7,76 Prozent den Einzug. Die Nachfolgepartei der „Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei (KSČ)“ verlor damit rund die Hälfte ihrer Stimmen im Vergleich zur vorherigen Wahl. Neben klassisch linken Forderungen nach mehr sozialer Gerechtigkeit und Umverteilung von Vermögen ist die KSČM, welche auch die EU-Mitgliedschaft Tschechiens immer wieder in Zweifel zieht, vor allem als scharfer Kritiker der NATO bekannt..
Am deutlichsten musste die oben angeführte „Tschechische Sozialdemokratische Partei (ČSSD)“ einstecken: Von vormals 20 fielen die Sozialdemokraten auf 7,27 Prozent zurück – so ist die jahrzehntelange Regierungspartei nur noch sechst stärkste Kraft im Parlament. Noch bei den Wahlen im Jahr 2013 konnte sich die ČSSD als stimmenstärkste Partei behaupten, stellt mit ihrem Parteivorsitzenden Bohuslav Sobotka nach wie vor den Ministerpräsidenten des Landes. Nachdem die Betrugsvorwürfe gegen seinen Finanzminister Babiš (ANO) unüberhörbar wurden, räumte Sobotka seinen Posten als Parteivorsitzender – kündigte aber an bis zu den Neuwahlen Ministerpräsident bleiben zu wollen.
Mit knappem Ergebnis schafften neben der ČSSD auch noch die „Christliche und Demokratische Union – Tschechoslowakische Volkspartei“ (5,80 Prozent), die konservative „TOP 09“ (5, 31 Prozent) und die liberal-konservative Bewegung „STAN“ (5,18 Prozent) den Einzug ins tschechische Abgeordnetenhaus. 60,84 Prozent der Tschechinnen und Tschechen beteiligten sich an der Abstimmung, geringfügig mehr als bei der Vor-Wahl 2013.
Warum steht ANO-Vorsitzender Babiš so massiv in der Kritik?
Nachdem die Umfragen im Vorfeld der Wahl bereits vermuten liesen, dass in Tschechien kein Stein auf dem anderen bleibt, gestalten sich Koalitionsverhandlungen entsprechend schwierig. Das Problem: Zwar ist die EU-kritische „Aktion unzufriedener Bürger“ stimmenstärkste Kraft – mit 78 von 101 benötigten Sitzen von einer Mehrheit jedoch weit entfernt. Neben ANO konnten acht weitere Parteien bzw. Listen die Fünf-Prozent-Hürde überspringen. Sechs von ihnen lehnen eine Koalition mit Babiš jedoch kategorisch ab, die konservative TOP 09 rief gar zur Blockade auf. Die Kommunistische Partei liebäugelt zwar mit der ANO-Bewegung, könnte im Fall der Fälle mit ihren 15 Sitzen jedoch auch nicht entscheidend zur Mehrheit im Abgeordnetenhaus beitragen. Einzig die rechtsradikale SPD zeigte sich koalitionswillig – ein Angebot, das wiederum Babiš ablehnte.
Warum aber ist der ANO-Vorsitzende so umstritten? Im Wahlkampf gingen er und seine Partei vor allem als „Anti-Establishment-Partei“ auf Stimmenfang, distanzierten sich klar von Korruption und dem politischen System des Landes. Diese Unzufriedenheit mit dem angeblich von Korruption durchwucherten politischen System kanalisierte man vor allem durch den Hass auf Flüchtlinge und Migranten. Nicht zuletzt Bundeskanzlerin Angela Merkel durfte sich ob ihrer Flüchtlingspolitik von dem tschechischen Großunternehmer immer wieder unschöne Worte anhören. Eine Erhöhung der Rente kündigte Babiš in seinem ansonsten frei von positiven Inhalten gefassten Wahlprogramm an. In weiten Strecken war sein Stimmenfang aber von den Worten „gegen“ und „Anti-“ begleitet. Er selbst inszenierte sich während seiner Kampagne vor allem als Saubermann, der diesen Laden mal richtig aufräumen wolle, besuchte ganz „volksnah“ mehrere Fabriken und erboste sich über „faule Arbeitslose“.
92 Millionen Euro EU-Fördergeld für die eigene Firma
Dabei zeigt ein Blick in den Lebenslauf des milliardenschweren Unternehmers, dass er selbst die gelebte Antithese zu seinem Wahlprogramm darstellt. Als Großunternehmer und zweitreichster Bürger Tschechiens ist er Eigentümer des Agrar- und Chemie Unternehmens Agrofert sowie dessen in 18 Ländern agierenden 250 Tochterbetrieben. Seit 1993 steht Babiš dem Konzern als Direktor vor, der sich seit der Übernahme zum viertgrößten Unternehmen und zum größten privaten Arbeitgeber Tschechiens entwickelt hatte. Eines der Tochterunternehmen ist die AGF Media a.s., welche u.a. zwei der drei auflagenstärksten Tageszeitungen im Land besitzt und dem außerdem diverse Internetportale, Fernsehsender und Druckereien unterstehen. Der Verdacht, dass der Eigentümer private Interessen und öffentliche Ämter gefährlich vermengen könnte, ist also durchaus gegeben.
Von 2004 bis 2013 erhielt eben jener Agrofert-Konzern EU-Fördergelder in Höhe von 160 Millionen Euro. Von 2014 bis 2015, in jener Zeit als Babiš selbst Finanzminister war, durfte sich das Chemieunternehmen über 92 Millionen Euro Förderung aus Brüssel freuen. Dass zahlreiche Agrofert-Manager wichtige Posten in Ministerien und Ausschüssen besetzten, durfte dem ansonsten EU-kritischen Babiš ganz gelegen gekommen sein. Der Verdacht auf Steuerbetrug sowie die Beeinflussung von Medien kostete den Großunternehmer schließlich den Job als Finanzminister. Er selbst schwört auf seine Unschuld, hinter den Anschuldigungen stecke eine „Kampagne des Establishments“.
Seit der Milliardär in den 1990ern das unternehmerische Parkett betreten hat, ist seine Laufbahn von gerichtlichen Auseinandersetzungen geprägt, ehemalige Mitarbeiter und Geschäftspartner bezichtigen ihn immer wieder des Betrugs. Und auch seine politischen Kritiker befürchten, dass Babiš seine öffentliche Macht zu seinen eigenen Gunsten missbrauchen wolle – nicht zuletzt durch die Kontrolle großer Teile der Medienlandschaft. Der Inhaber wichtiger Medien des Landes könne sich ganz einfach der oppositionellen Kontrolle entziehen, in einem Ausmaß, das für eine Demokratie nur wenig förderlich ist.
Ganz anders das Bild, das Babiš seinen Wählerinnen und Wählern vermitteln möchte. Als „Anti-System-Kämpfer“, der Schluss machen will mit Korruption und Machtmissbrauch, weiß er die Unzufriedenheit im Land zu nutzen, wird nicht müde zu betonen, wie Flüchtlinge und Migranten den hart erarbeiteten Wohlstand der Tschechen bedrohen würden. Einen „schlanken Staat“ wolle er, der ähnlich einem Unternehmen effizient arbeitet und harte, ehrliche Arbeit endlich wieder belohnt.
Das Einmaleins des Populismus
Der Spitzenkandidat der EU-kritischen ANO reiht sich dabei nicht nur ein in den Brüssel’schen Kritikenchor, sondern folgt mittlerweile altbekannten Mustern von Parteien und Bewegungen der populistischen Rechten. Ein eiserner Nationalismus, gepaart mit demokratisch fragwürdigen Machtansprüchen sowie rhetorischen Kampansagen in Dauerschleife sowohl an die Feinde im Innern („das Establishment“) als auch im Äußern („Flüchtlinge“ und „Migranten“) sind auch in Frankreich mit Le Pens Front National oder in der österreichischen FPÖ fixer Bestandteil des rechten Randes. Was den Fall Babiš jedoch von Front National, AfD, FPÖ und Co. unterscheidet ist der durchaus fragwürdige Umgang mit der Justiz und die besorgniserregende Kontrolle von Medien und Meinungsmache im Land (wie das auch in Ungarn, Polen oder in den USA der Fall ist bzw. bei Berlusconi der Fall war).
Doch trotz der frappierenden Widersprüche innerhalb der Persona Babiš konnte dieser bei der Wahl am 20. und 21. Oktober die meisten Stimmen für sich und seine Partei gewinnen. In der Tat ist Tschechien ein Land, das immer wieder von Korruptionsskandalen erschüttert wurde – Korruption habe eine gewisse „Tradition“ dort, heißt es aus Expertenkreisen. Trotzdem ist dieser Hass aufs Etablierte, aufs System und die politische Klasse an sich, die nicht nur ANO den Wahlsieg bescherte, sondern gleich vier Anti-System-Parteien den Einzug ins Parlament sicherte, in gewissem Maße erstaunlich. In Anbetracht der derzeitigen Situation Tschechiens fallen einem nur wenig Gründe ein, die diese generelle „Unzufriedenheit“ auf argumentativ sicheren Boden stellen könnten.
Seit der samtenen Revolution im November 1989 legte der Visegrád-Staat eine rasante Entwicklung hin. Ähnlich wie Polen, Ungarn und die Slowakei vervielfachte sich die wirtschaftliche Leistung des Landes binnen kurzer Zeit, zahlreiche gesellschaftliche Bewegungen entstanden, international angesehene Universitäten und Kultureinrichtungen etablierten sich. Relativ zeitig, so die damals gängige Expertenmeinung, würde sich Tschechien zu einer „stabilen Demokratie“ entwickeln. Heute sieht man sich zunehmend mit dem Vorwurf eines „vorschnellen Schlusses“ konfrontiert.
Dass der populistische Mix aus Anti-Einwanderer-Rhetorik und der Ruf nach einem neuen Politik-Stil so großen Anklang findet, verwundert bei genauerer Betrachtung. Genau zwölf (!) Flüchtlinge hat die Tschechische Republik im Zuge des EU-Umverteilungsprogramms aufgenommen, danach beantragte man einen Stopp des Relocation-Abkommens, man sehe die Sicherheit des Landes gefährdet. Die Wirtschaft erfreut sich derweil boomender Wachstumszahlen, im Land herrscht nahezu Vollbeschäftigung. Den Migranten, der den einheimischen Tschechen den Job wegstibitzt, sucht man hier vergeblich. Im Gegenteil: Dank florierender Wirtschaft ist man auf Zuwanderung angewiesen, um die hohe Nachfrage nach Beschäftigten erfüllen zu können.
Wie geht’s jetzt weiter?
„Wir sind keine Gefahr für die Demokratie“, erklärt Babiš unmittelbar nach der Veröffentlichung der ersten Hochrechnungen. Ob der Milliardär sein Versprechen hält, bleibt zunächst einmal abzuwarten. Fest steht, eine einfache Legislaturperiode steht Babiš nicht bevor. Da eine Koalition mit einer der anderen acht Parteien ausgesprochen schwierig zu machen scheint, kündigte der umstrittene Großunternehmer an, eine Minderheitenregierung mit Unterstützung von Experten anzustreben. Den nötigen Regierungsbildungsauftrag hat er bereits von Präsident Miloš Zeman erhalten, bis Weihnachten werde ein Regierungsprogramm stehen, so der ANO-Vorsitzende. Bis es soweit ist, muss das gesamte Abgeordnetenhaus jedoch einer Minderheitenregierung der ANO-Bewegung und Babiš‘ Ministerpräsidentschaft in einer Abstimmung mehrheitlich zustimmen. Ob das geschehen wird, bleibt fraglich. Am 20. November trifft man hierzu zu einer konstituierenden Sitzung zusammen.
Johannes Greß