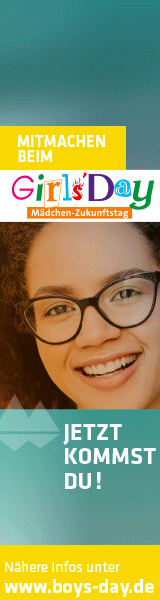Sie erfüllen Aufgaben, die für eine funktionierende Gesellschaft unverzichtbar sind: Menschen in sozialen Berufen. Trotzdem ernten sie für ihre körperlich und psychisch oft anstrengende Arbeit kaum Anerkennung. Ihr Job ist nicht nur weit weniger angesehen als beispielsweise die Arbeit eines Ingenieurs oder Unternehmers – in sozialen Berufen verdient man meist auch nicht besonders gut. Warum gehen Menschen Jobs wie Krankenpfleger, Erzieher oder Altenpfleger trotzdem nach? Da Hogn trifft Vertreter ihres Berufsstandes, die erzählen, wo die größten Herausforderungen liegen – warum sie aber auch mit niemandem tauschen möchten. Folge 1: Altenpfleger.
__________________________
Freyung/Neureichenau. Fremden, betagten Menschen die Windeln wechseln, ihnen die Fußnägel schneiden, mit Wutausbrüchen demenzkranker Senioren klar kommen – und ständig auch mit dem Tod derjenigen, die man pflegt, konfrontiert sein. So sieht der Alltag eines Altenpflegers aus. Und am Ende des Monats landet auch nach vieljähriger Berufserfahrung kein leistungsgerechtes Gehalt auf dem Konto. Warum entscheidet man sich trotzdem für den Beruf des Altenpflegers? Und warum werden diese Menschen in unserer Gesellschaft nicht dementsprechend Wert geschätzt?
„Mama und Papa haben gesagt: Schau Dir halt ein Büro an“
„Ich könnte nicht einen Tag nennen, an dem ich nicht gerne in die Arbeit gegangen bin.“ Annemarie Sammer (52) arbeitet seit fast 35 Jahren im Caritas-Seniorenheim in Freyung. Wenn sie von ihrer Arbeit erzählt, merkt man schnell, dass es für sie keine Alternative gäbe – auch wenn sie durchaus von schwierigen Seiten ihres Berufs berichtet. Auch für Jasmin Feichtinger (27) stand nach der Realschule sofort fest: Ich werde Altenpflegerin. „Mama und Papa haben gesagt: Schau Dir halt ein Büro an – aber ich war mir sicher: Ich setz mich nicht irgendwo rein.“ Auch sie hat die Entscheidung nie bereut. Seit zehn Jahren ist sie im Rosenium in Neureichenau für alte und pflegebedürftige Menschen da.

Einen sozialen Beruf zu erlernen, wird immer unbeliebter. Trotzdem gibt es Menschen wie Annemarie Sammer, die sich keine andere Tätigkeit vorstellen können.
Schon während der Schulzeit war Jasmin in den Ferien ab und zu im Heim präsent, hat ihre Tante begleitet, die ebenfalls Altenpflegerin ist. Im Gegensatz zu vielen anderen jungen Berufsanfängern hatte ihr die Ausbildung dann auch Spaß gemacht. „Manche halten nicht durch und brechen ab“, berichtet sie. „Weil sie mit dem Sterben nicht zurecht kommen.“ Schwierig sei vor allem, dass man den Heimbewohnern auf der einen Seite Nähe geben soll, gleichzeitig aber auch eine gewisse Distanz zu ihnen wahren muss. Um auch nach der Arbeit abschalten zu können. Das ist nicht jedermanns Sache.
Wenn sie von ihrem Joballtag erzählt, weiß man, wie belastend dieser sein kann. „Einmal hat ein Bewohner nur noch geweint – dann hat er auf ein Bild seines Sohnes gedeutet und noch mehr geweint“, berichtet sie. Man wisse in solchen Situationen oft nicht, was genau in den Leuten vorgehe, da sie dies häufig nicht mehr ausdrücken können. Man sei da auch schon mal hilflos. „Das ist schwer.“
„Das Personal ist nach wie vor extrem knapp bemessen“
Auch Annemarie weiß von solchen Vorkommnissen: „Wenn jemand nichts mehr artikulieren kann, mache ich es so, wie ich es mir selbst wünschen würde. Wie und wann man mich ins Bett legt, was man mir zu essen gibt. Damit liegt man immer richtig.“ Annemarie gehört ebenso zu denjenigen Altenpflegerinnen, die ihren Beruf trotz all seiner Härten lieben. „Ich hab vom ersten Moment an gespürt, wie gut das tut, wenn die Dankbarkeit von den alten Menschen zurückkommt“, sagt sie. Schwierige Situationen entstehen für sie aber im Joballtag trotzdem. Vor allem dann, wenn die Bewohner jünger sind als sie. „Die Alten haben ihr Leben gelebt, damit kann ich umgehen.“ Wenn allerdings ein Bewohner mit Mitte 40 bereits so krank ist, dass er rund um die Uhr betreut werden muss, sei dies besonders schwierig. Trotzdem baue sie zu jedem Bewohner eine gewisse Bindung auf – auch wenn Sterbefälle einem dann näher gehen. „Ohne das würde es für mich nicht funktionieren.“

Für Jasmin Feichtinger (27) stand nach der Schule schnell fest, dass sie Altenpflegerin werden möchte.
Es klingt keinesfalls nach Jammern oder Wehklagen, wenn Annemarie von ihrem psychisch wie körperlich belastenden Arbeitsalltag erzählt. Während andere ständig über ihren Job lästern, hat man bei ihr eher das Gefühl, dass sie über ihre Lebensaufgabe spricht. Bei der es aber ganz klar Dinge gibt, die nicht optimal laufen.
Etwa, dass im Arbeitsalltag kaum Zeit für diejenigen Dinge bleibt, die über die Grundversorgung der alten Menschen hinausgehen. „Wenn man nur mal zehn Minuten da sitzt und mit ihnen redet, merkt man, wie gut ihnen das tut“, sagt Jasmin. Gelegenheit dazu haben die Altenpflegerinnen jedoch selten: Es ist genau vorgegeben, wie viel Personal für welche Leistungen bezahlt wird. Bis vor kurzem gab es die so genannte Minutenpflege: Alle Arbeitsschritte mussten in einer von den Krankenkassen vorgegebenen Zeitspanne erledigt werden. Sowohl Annemarie als auch Jasmin empfanden dies als sehr negativ. Nun gibt es die sogenannten Pflegegrade. „Aber die ändern an der grundlegenden Situation eigentlich nichts: Das Personal ist nach wie vor extrem knapp bemessen“, weiß Annemarie.
„Früher die Bewohner gepflegt – heute die Dokumentation“
Kräftezehrend am Beruf des Altenpflegers ist außerdem, dass die Fachkräfte im Schichtdienst arbeiten müssen. Es gibt Frühschichten, Spätschichten, Nachtschichten – und die unbeliebten Teilschichten. Wer Teilschicht arbeitet, kommt morgens ein paar Stunden zur Arbeit, hat dann ein paar Stunden frei – und ist nachmittags dann nochmal ein paar Stunden im Einsatz. „Der Schichtdienst ist schwierig, man kann mit Freunden oft nicht weggehen“, sagt Jasmin. Wenn andere frei haben – an Wochenenden oder Feiertagen – dann ist sie im Einsatz. Positiv ist aus ihrer Sicht: Die Schichtarbeit ist recht flexibel einteilbar. Als Mutter eines einjährigen Sohnes kommt ihr dies jetzt zu Gute. Auch Nachtschichten möchte Jasmin bald wieder machen. Sie kommt mit dem Tag-Nacht-Wechsel gut zurecht, sagt sie.

Altenpflegerinnen wie Annemarie haben einen psychisch wie physisch anstrengenden Job. Ohne ihren Einsatz hätte unsere Gesellschaft ein Problem.
Trotz Nachteinsätzen verdient Jasmin jedoch bei Weitem kein Vermögen. Und auch Annemarie hat nach 30 Jahren im Beruf am Ende des Monats nur in etwa das auf dem Konto, was ein Bankkaufmann direkt nach der Ausbildung bekommt. Dabei leisten sie nicht nur in der Praxis viel. Bereits die Ausbildung ist anspruchsvoll: Anatomie, psychiatrisches Wissen über Demenz und Depressionen, Medikamentenkunde etc. „Mein Sohn lernt gerade Einzelhandelskaufmann. Das ist im Vergleich kaum Lernstoff“, erzählt Annemarie.
In der Altenpflege sind die Aufstiegschancen zudem sehr eingeschränkt. Man kann die Pflegedienstleitung übernehmen. Diese Stellen sind aber rar gesät. Ansonsten bleibt man ein Leben lang auf nahezu demselben Gehaltsniveau. Jasmin hat eine Zusatzausbildung zur Praxisanleiterin gemacht – das bedeutet: Sie lernt jetzt neue Mitarbeiter an und beurteilt Auszubildende. Das bringt ihr mehr Geld. Bei Annemaries Arbeitgeber, der Caritas, werden solche Zusatzqualifikationen dagegen nicht vergütet.
Sie beschwert sich aber nicht über ihr Einkommen. Auch Jasmin sagt: „Wer so einen Beruf macht, schaut wahrscheinlich ohnehin weniger aufs Geld.“ Was beide viel mehr stört, ist die fehlende Zeit, sich in Ruhe auf die Bewohner einlassen zu können. Und das ist wohl in allen Heimen gleich. Viel Zeit gehe vor allem deshalb verloren, weil Altenpfleger jeden Arbeitsschritt schriftlich dokumentieren müssen, finden sowohl Annemarie als auch Jasmin. Um nachzuweisen, was sie gemacht haben – und was sie bei der Krankenkasse abrechnen dürfen. „Früher haben wir die Bewohner gepflegt – heute pflegen wir die Dokumentation“, bringt es Annemarie auf den Punkt.
Altenpfleger zu finden ist gar nicht so einfach für ein Heim
Mit dem so genannten Pflege-TÜV ist ein weiteres Ärgernis dazu gekommen: Was auf den ersten Blick gut klingt – die Arbeit der Heime soll bewertet werden, damit man an einer Note sehen kann, ob alte Menschen hier gut aufgehoben sind -, funktioniert Annemarie zufolge in der Praxis eher schlecht. Die Kontrollinstanzen, die die Arbeit der Altenpfleger bewerten, sind meist berufsfremd, sprich: Beamte, die mit dieser Aufgabe betraut wurden. Sie arbeiten einen festgelegten Bewertungskatalog ab. „Ob das, was auf dem Papier steht, tatsächlich gemacht wird, kann man ja nicht wirklich nachprüfen“, meint Annemarie. Und die Befragung der Bewohner mache nur einen geringen Teil von der Gesamtnote eines Heimes aus.
„Sie schauen sich weniger die Leute an, sondern viel mehr den Papierkram“, berichtet die 52-Jährige von den Kontrollen. Wichtig für eine gute Note ist etwa die Frage: Welche Schuhe die Altenpfleger tragen. Ob Verfallsdaten von Medikamenten peinlich genau eingehalten werden. Oder Hygienevorschriften, wie und wo Pflegematerialien gelagert sein müssen. Ein Beispiel: Nagelscheren müssen sofort nach der Benutzung desinfiziert und in den Schrank geräumt werden. Bei einer Kontrolle lag eine Schere noch auf dem Badewannenrand. „Das gab in diesem Teilbereich Note fünf.“ Ihr Hauptkritikpunkt am Pflege-TÜV: „Da fließt so viel Geld rein – statt es für die Pflege selbst zu verwenden!“ Mehr Personal würde in ihren Augen viel mehr verbessern als dieses zweifelhafte Benotungssystem.
Doch selbst wenn mehr Geld für mehr Personal da wäre: Altenpfleger zu finden ist gar nicht so einfach für ein Heim. Es mangelt extrem an Fachkräften – kaum einer will eine Ausbildung in diesem Beruf machen. Viele können es sich einfach nicht vorstellen, gebrechliche Fremde zu waschen oder ihre Ausscheidungen zu riechen. Ein weiterer Grund ist sicherlich auch der niedrige Stellenwert, den soziale Berufe in unserer Gesellschaft haben. Das sei aber erst mit der Zeit so gekommen, sagt Annemarie. „In den 80er Jahren war der Beruf der ‚Schwester‘ noch ein halber Doktor.“ Warum ist das jetzt nicht mehr so? „Es wird auch immer nur das Negative berichtet und gezeigt“, wie Annemarie findet.
„Heute kommen meist nur noch die absoluten Härtefälle“
Außerdem fällt ihr auf: Das Thema Sterben wird in unserer Kultur mehr und mehr totgeschwiegen. Zum Sterben kommen viele ins Heim. „Früher hatten wir auch noch viel gesündere Bewohner – heute kommen meist nur noch die absoluten Härtefälle.“ Dass jemand zu Hause stirbt und die ganze Familie danach am Totenbett sitzt, ist so gut wie unvorstellbar. Die Altenpfleger kümmern sich um die Härtefälle und begleiten sie bis zum Schluss – wofür sie mehr Geld und mehr Anerkennung verdient hätten.
Sabine Simon