(Die Antwort von Hubert Demmelbauer, Vorsitzender der „Bürgerbewegung zum Schutz des Bayerischen Waldes“, zum von Nationalpark-Pressesprecherin Dr. Kristin Beck verfassten Bericht „Jetzt mal Tacheles: Naturzone, IUCN-Richtlinien & Nationalparkverordnung“): „Als Reaktion auf das Hog’n-Interview musste Dr. Kristin Beck im Auftrag der Nationalparkleitung eine Faktenübersicht zur Verfügung stellen, die Missverständnisse aufklären und falsche Interpretationen ausräumen sollte. Mir wollte man damit ‚ein wenig Nachhilfe in Sachen Naturzone, IUCN-Richtlinien und Nationalparkverordnung erteilen‘ und dabei ‚Tacheles reden‘. Ich schätze es, wenn Klartext gesprochen wird – Wischiwaschi mag ich aber nicht. Deshalb möchte ich einiges klar stellen:

Hochlagenwald im Falkensteingebiet. Nach dem Orkan Kyrill wurden hier Tausende vom Sturm entwurzelte und gebrochene Fichten nicht aufgearbeitet. Sie blieben liegen und dienten den Borkenkäfern zur Brut. In der Folge entstanden riesige Kahlflächen. Fotos: Demmelbauer
- Die rechtlichen Grundlagen für den Schutz der Natur im Nationalpark
„Der Nationalpark wird nach den Richtlinien der Weltnaturschutzorganisation IUCN als Schutzgebiet der Kategorie II, also als „Nationalpark“ verwaltet und entwickelt. Eine Entwicklung (…) als sogenanntes „Wildnisgebiet“ steht nicht zur Debatte. Auch das aktuelle Management des Nationalparks Bayerischer Wald gibt keinerlei Anlass, dies anzunehmen.“
Das schreibt Dr. Kristin Beck und beruft sich dabei auf „Richtlinien für die Anwendung der IUCN-Managementkategorien für Schutzgebiete“, die der britische Umwelt-Journalist und Naturschutz-Funktionär Nigel Dudley im Jahr 2008 herausgegeben hat. Er weist darauf hin, dass die Ansichten, die er darin vertritt, nicht unbedingt die Meinung der IUCN oder anderer beteiligter Organisationen wiedergeben. Für seine Richtlinien zur Anwendung der IUCN-Managementkategorien von 2008 und 2013 gibt es auch noch keine von der Weltnaturschutzunion autorisierte Übersetzung in andere Sprachen.
„Die Rechtsgrundlage ist das Bundesnaturschutzgesetz“
Wohl deshalb hat die Nationalparkverwaltung auf ihrer Homepage unter der Rubrik „Rechtliche Grundlagen“ auch noch die „Richtlinien für Management-Kategorien von Schutzgebieten – Interpretation und Anwendung der Management-Kategorien in Europa“ von EUROPARC und IUCN aus dem Jahr 2000 zum Download bereitgestellt. Diese basieren ebenso wie die von Dudley auf den von der IUCN mit Unterstützung des World Conservation Monitoring Centre herausgegebenen „Richtlinien für Management-Kategorien (IUCN 1994)“. Das Kerndokument ist auch in die deutsche Sprache übersetzt worden. Zweck der grundlegenden IUCN-Richtlinien von 1994 sollte es sein, nach einheitlichen Kriterien „eine Ordnung in die Vielfalt der Schutzgebiete in aller Welt zu bringen“.
Die IUCN-Richtlinien stellen Empfehlungen für die Mitgliedsstaaten dar. Sie sind keine rechtsverbindlichen Vorschriften. Nationalparke sollen die Unversehrtheit der Ökosysteme schützen. Dort, wo in der Vergangenheit die ökologischen Verhältnisse in einem Schutzgebiet gestört worden sind, muss unter Umständen eine „Wiedergutmachung“ stattfinden. So sollen auch nach den Empfehlungen von Dudley in einem Nationalpark aktive, zeitlich begrenzte Eingriffe erfolgen, um früher entstandene Schäden an den Ökosystemen zu reparieren („Restoration“).

Der Zwieseler Hubert Demmelbauer ist Vositzender der „Bürgerbewegung zum Schutz des Bayerischen Waldes“.
In den Schutzgebieten der Management-Kategorie Ia und Ib (Strenges Naturreservat/Wildnisgebiet) soll die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands allein durch natürliche Prozesse erfolgen – also nicht durch aktive Eingriffe. Im Gegensatz zu einem „Wildnisgebiet“ ist aber die Natur in einem „Nationalpark“ nicht unbedingt sich selbst zu überlassen. Vielmehr sind regulierende Eingriffe durchzuführen, wenn diese nach wissenschaftlichen Erkenntnissen erforderlich sind. Das gilt zum Beispiel für Maßnahmen des Waldschutzes, für die Sicherung der Artenvielfalt durch regulierende Maßnahmen des Schalenwild-Managements, bei der Wiedereinbürgerung von verschwundenen Tierarten und auch beim Erhalt kulturhistorisch wertvoller Flächen und Denkmale. Die IUCN-Richtlinien schreiben keineswegs vor, dass in einem Nationalpark 75 Prozent seines Gebietes frei sein müssen vom Einfluss des Menschen. So wird nach den Regeln der IUCN auch der Nationalpark Šumava seit 1997 international anerkannt als Nationalpark der Management-Kategorie II – obwohl in diesem Schutzgebiet die vom Menschen unbeeinflusste „Kernzone“ nur 13 Prozent der Fläche umfasst.
Die entscheidende Rechtsgrundlage für alle deutschen Nationalparke ist seit dem 1. März 2010 das Bundesnaturschutzgesetz.
Dass der Bundesgesetzgeber die Schutzkategorie „Nationalpark“ für Deutschland verbindlich für alle Bundesländer definiert hat und im Bundesnaturschutzgesetz auch vorgibt, welches Ziel Nationalparke haben und wie sie unter Berücksichtigung ihres besonderen Schutzzwecks zu schützen sind, wird in der Stellungnahme der Nationalparkverwaltung mit keinem Wort erwähnt. Deshalb hier ein Zitat aus dem Paragrafen 24 BNatSchG („Nationalparke“):
„Ein Prozessschutz ohne Einflussnahme ist ausgeschlossen“
„Nationalparke sind rechtsverbindlich festgesetzte einheitlich zu schützende Gebiete, die sich in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets in einem vom Menschen nicht oder wenig beeinflussten Zustand befinden oder geeignet sind, sich in einen Zustand zu entwickeln oder in einen Zustand entwickelt zu werden, der einen möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik gewährleistet (…). Soweit es der Schutzzweck erlaubt, sollen Nationalparke auch der wissenschaftlichen Umweltbeobachtung, der naturkundlichen Bildung und dem Naturerlebnis der Bevölkerung dienen.“

Ziel des Nationalparks: „Ein möglichst ungestörter Ablauf der Naturvorgänge in einem überwiegenden Teil ihres Gebietes“ (Hier ein Bild des Waldes am Rachel).
Nationalparke in Deutschland müssen also nicht auf 75 Prozent ihres Gebiets zu einer Fläche entwickelt werden, auf die der Mensch keinen Einfluss nimmt (Naturzone). Ein absoluter „Prozessschutz“ ohne jegliche Einflussnahme des Menschen ist ausgeschlossen, wenn er sich gegen die Zweckbestimmung des Nationalparks richtet (z. B. die Erhaltung einer für Mitteleuropa charakteristischen bewaldeten Mittelgebirgslandschaft mit ihren heimischen Tier- und Pflanzengesellschaften, insbesondere ihren natürlichen und naturnahen Waldökosystemen). Aus gutem Grund hat der Gesetzgeber deshalb für Nationalparke den „möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets„ als Ziel vorgegeben. Weil das bayerische Naturschutzrecht an das neue Bundesnaturschutzgesetz angepasst werden musste, beschloss der Bayerische Landtag am 10. Februar 2011 ein neues „Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur (BayNatSchG)“.
Die Rechtsverordnung ist aber bis heute nicht an das neue Bundesnaturschutzgesetz angepasst worden, obwohl der durch Regierungsdekret vom 17. September 2007 nachträglich eingefügte Paragraf 12a „Naturzone“ überhaupt nicht vereinbar ist mit dem Paragrafen 24 „Nationalparke“ BNatSchG. Die zwingende Vorgabe der Staatsregierung im § 12a Nationalparkverordnung, bis zum Jahr 2027 75 Prozent des Nationalparkgebiets zu einer Fläche zu entwickeln, auf die der Mensch keinen Einfluss nehmen darf, führt obligatorisch zum totalen „Prozessschutz“. Das Ergebnis ist ein „Wildnisgebiet“, das nach dem Bundesnaturschutzgesetz als Schutzkategorie zur Verhinderung menschlichen Einflusses nicht zulässig ist.
- Soll der Nationalpark Bayerischer Wald ein Wildnisgebiet werden?
Im Bundesnaturschutzgesetz ist als Grundsatz festgelegt, dass Teile von Natur und Landschaft als Naturschutzgebiet, Nationalpark, Nationales Naturmonument, Biosphärenreservat, Landschaftsschutzgebiet, Naturpark, Naturdenkmal oder geschützter Landschaftsbestandteil geschützt werden können. Bei diesem Katalog handelt es sich um eine abschließende Aufzählung, welche die Länder weder verkürzen noch erweitern können. So ist die Ausweisung von „Wildnisgebieten“ als eigene Schutzkategorie nicht vorgesehen und deshalb unzulässig.

Titel-Folie aus der gemeinsamen Präsentation der Nationalparkverwaltungen Bayerischer Wald und Šumava zum Projekt „EUROPAS WILDES HERZ“ bei der 9. Weltwildniskonferenz in Mexiko 2009.
Dennoch hat die Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald bisher alles getan, um große Teile des Parks als Wildnisgebiete im Sinne der Schutzgebietskategorie Ib nach den Kriterien der IUCN zu deklarieren. Schon im Jahr 2008 ließ sie in Zusammenarbeit mit der Nationalparkverwaltung Šumava ein Faltblatt drucken, in dem ausdrücklich die Entwicklung eines „Wildnisgebietes nach den Kriterien der IUCN im Kernbereich beider Nationalparke“ propagiert wurde.
In diesem Werbeblatt der Nationalparkverwaltung wird ausgeführt, dass ein Wildnisgebiet der Schutzgebietskategorie Ib nach IUCN ein vom Menschen weitgehend unbeeinflusstes Gebiet ist, das Forschungszwecken dient, in dem keine umfassenden Managementmaßnahmen zulässig sind und die touristische Nutzung auf das Begehen von ausgewiesenen Wanderwegen beschränkt ist.
Was es mit dem Porjekt „Europas wildes Herz“ auf sich hat …
Unter dem Projektnamen „EUROPAS WILDES HERZ“ sollte bis 2028 das geplante Wildnisgebiet auf zirka 250 Quadratkilometer ausgedehnt werden. Der kuriose Hinweis der Nationalpark-Pressesprecherin, dass „die Besuchernutzung im Wildnisgebiet auf diejenigen beschränkt sei, die die Fähigkeiten und die Ausrüstung haben, ohne Hilfestellung in der Wildnis zu überleben”, ist in dem Faltblatt nicht enthalten. Als erstmals im Frühjahr 2009 über das Projekt in der Presse (Straubinger Tagblatt) berichtet wurde, formierte sich im Landkreis Regen der Widerstand gegen das Wildnis-Projekt.

Vorbildliches Landschaftsbild: Der Hochlagenwald am Falkenstein.
Verärgert über die unzureichende Information und die mangelnde Transparenz des Wildniskonzepts der Nationalparkverwaltung lehnten die Mitglieder des Kreistags Regen bei ihrer Sitzung am 15. Juli 2009 die Ausweisung eines Wildnisgebietes der IUCN-Kategorie Ib mit überwältigender Mehrheit ab (Stimmenverhältnis 48 : 3). In Folge musste der damalige Leiter der Nationalparkverwaltung, Karl Friedrich Sinner, versprechen, dieses Projekt nicht weiter zu verfolgen. Trotzdem brachte er bei der 9. Weltwildniskonferenz in Merida/Mexiko am 13. November 2009 eine Resolution auf den Weg, mit der das Europäische Parlament und die Regierungen der Mitgliedsstaaten ersucht wurden, Wildnisgebiete der IUCN-Kategorie Ib nach dem US-amerikanischen Wildnis-Konzept auch in Europa auszuweisen.
Außerdem wurde noch eine weitere Resolution eingebracht unter dem Titel „Grenzüberschreitender Wildnisschutz an der Tschechisch-Bayerischen Grenze“. Diese war eine Aufforderung an die Gesetzgeber in Bayern, der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik, das gemeinsame Kerngebiet der Nationalparke Bayerischer Wald und Šumava in den Rechtsstatus eines IUCN-Schutzgebietes der Management-Kategorie Ib („Wildnisgebiet“) zu überführen und den Begriff „Wildnis“ in den Umweltgesetzen zu verankern. Das 15.000 Hektar große Kerngebiet der beiden Nationalparke erfülle effektiv die Voraussetzungen eines „de facto – Wildnisgebiets“ und solle deshalb baldmöglichst durch die Gesetzgeber in den „de jure – Status“ eines IUCN-Schutzgebietes der Kategorie Ib überführt werden.
Der Nationalpark wirbt mit dem Slogan „Grenzenlose Waldwildnis“
Im Oktober 2010 wurde das Jubiläum „40 Jahre Nationalpark Bayerischer Wald“ gefeiert. Zu diesem Anlass betonte die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, Prof. Dr. Beate Jessel, in einem Brief, dass die Zeitspanne von 40 Jahren bezogen auf Wildnisgebiete erst die Startphase sein könne. Weil der Nationalpark mit dem Slogan „Grenzenlose Waldwildnis“ wirbt, solle die grenzüberschreitende Situation mit dem Nationalpark Šumava dazu genutzt werden, ein Wildnisgebiet gemäß Kategorie Ib der IUCN zu etablieren. Die Auswirkungen der Wildnisentwicklung und weiterer ökologischer Prozesse auf die Artenzusammensetzung seien im Rahmen eines Monitorings zu dokumentieren. Prof. Dr. Jessel ahnte damals nicht, dass die Nationalparkverwaltung 2015 solche Wildnisgebiete in Verbindung bringen würde mit der Kunst des Überlebens ohne fremde Hilfe in der Wildnis. Und das nur, um davon abzulenken, dass im Nationalpark Bayerischer Wald der „Schutz der Wildnis“ schon längst zum vorrangigen Managementziel erhoben worden ist.

Die Borkenkäfer haben im Bärnloch, nördlich von Zwieselerwaldhaus, innerhalb von fünf Jahren einen Großteil der Fichtenbestände zum Absterben gebracht.
Im April 2011 beklagte der Grünen-Politiker Eike Hallitzky, dass im Nationalpark Šumava ein Kurswechsel beim Borkenkäfer-Management stattgefunden habe und deshalb „dem einzigartigen grenzüberschreitenden Wildnisgebiet an der bayerisch-böhmischen Grenze das Aus droht“. In einer Pressemitteilung titelte er: „Das wilde Herz Europas ist in Gefahr!“
Im Jahr 2013 veröffentlichte die Europäische Kommission Richtlinien zum Management von Wildnis und Wildnisgebieten im Netzwerk „Natura 2000“ (Technical Report – 2013 – 069). Der Nationalpark Bayerischer Wald ist das größte terrestrische Natura 2000-Gebiet in Deutschland. Aus diesem Report ist zu ersehen, dass in den Wildnisgebieten des Nationalparks – das sind die „Naturzonen“ – auf einer Fläche von rund 13.000 Hektar Fallstudien zum „Wildnis-Management“ durchgeführt worden sind. Der Bericht bezieht sich auf die Auskunft der Nationalparkverwaltung. Das „Wildnis-Management“ des Nationalparks Bayerischer Wald beinhaltet Renaturierungen im großen Maßstab. Deshalb seien in den vergangenen 10, 15 Jahren Dutzende Kilometer von Forststraßen beseitigt bzw. renaturiert worden. Am Beispiel des Nationalparks Bayerischer Wald beschreibt die Europäische Kommission außerdem die politischen Herausforderungen, die sich beim „Wildnis-Management“ aus dem Gewähren lassen der Borkenkäfer ergeben haben.
Endlich spielen wir in der Champions League der Schutzgebiete
Die Nationalparkverwaltung will von diesen Dingen offenbar nichts wissen. Wie könnte die Pressesprecherin Beck sonst behaupten, dass „eine Entwicklung nach Kategorie Ib, also als sogenanntes ‚Wildnisgebiet‘ nicht zur Debatte steht und auch das aktuelle Management des Nationalparks Bayerischer Wald keinerlei Anlass gibt, das anzunehmen“? Warum hat die Nationalparkverwaltung nach der Ausweisung von „Naturzonen“ die ehemaligen Forstwege „renaturiert“, d. h. zerstört? Das Tal der Großen Deffernik nördlich von Zwieslerwaldhaus („Bärnloch“) und das Stubenbachtal östlich des Schachtenhauses („Gfällei“) sind so für die Wanderer unzugänglich gemacht worden. Die Borkenkäfer haben innerhalb von fünf Jahren einen Großteil der Fichtenbestände zum Absterben gebracht. Wildnis pur!
Die „Naturzone“ im Nationalpark umfasst jetzt schon 58 Prozent der Gesamtfläche. Sie wird jedes Jahr erweitert, bis zum Jahr 2027 drei Viertel der Nationalparkfläche frei sind vom Einfluss des Menschen. Dann kann die Nationalparkverwaltung stolz verkünden: Wir haben jetzt keinen Nationalpark mehr, sondern ein Wildnisgebiet! Endlich spielen wir in der Champions League international anerkannter Schutzgebiete – so wie der Schweizerische Nationalpark!
- „Kahlflächen im Hochlagenwald können nicht als Naturzonen ausgewiesen werden, weil das die Nationalparkverordnung bis 2027 verbietet!“
Das erklärte der ehemalige Nationalparkleiter Sinner den Mitgliedern des Bayerischen Landtags am 20. Mai 2010 in den Hochlagen am Lackaberg. Er berief sich auf die Verordnung über den Nationalpark, die der Bayerische Landtag am 10. Juli 1997 beschlossen hatte und die am 17. September 2007 durch Einfügen des „Naturzonen“-Paragrafen 12a geändert worden war. Dies war begründet worden mit dem falschen Argument, dass der Europarat in Verbindung mit dem Europadiplom für den Nationalpark ein Zonierungskonzept gefordert habe.

Dieses Bild entstand im Gfällei (Schachtenhaus).
In diesem Zusammenhang muss auch erinnert werden an den Beschluss des Bayerischen Landtags vom 10. Juli 1997, den Nationalpark zu erweitern und den Hochlagenwald besonders zu schützen. Der Landtag erließ eine Verordnung, in der ausdrücklich festgelegt wurde, dass „zwischen Rachel und Falkenstein in den Hochlagen die bisherige Borkenkäferbekämpfung fortgeführt und aktive Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit ein Übergreifen der Borkenkäferkatastrophe auf den Hochlagenwald für die nächsten 20 Jahre zuverlässig verhindert wird“. Nach Ablauf der 20 Jahre sollten dann die Nachfolger im entscheiden, „ob man im Erweiterungsgebiet auf menschliche Eingriffe völlig verzichten kann“.
Kristin Beck betont, dass die Nationalparkverordnung den Charakter einer gesetzlichen Vorschrift hat und deshalb verbindlich einzuhalten ist. Warum ignoriert die Nationalparkverwaltung die gesetzliche Vorschrift des Paragrafen 14 Absatz 2, die sie verpflichtet, den Hochlagenwald in seiner Substanz zu erhalten und in seiner Funktion zu sichern? Warum weigert sie sich, die notwendigen Maßnahmen der Walderhaltung und der Walderneuerung durchzuführen? Gemäß Paragraf 14 Absatz 4 der Nationalparkverordnung soll die Entwicklung einer standortgerechten, natürlichen Waldzusammensetzung unterstützt werden, wenn die natürliche Walderneuerung flächig und längerfristig ausbleibt. Die Verjüngungsdichte in den Hochlagen des Falkenstein-Rachel-Gebietes hat – nach Angaben der Nationalparkverwaltung – einen Wert erreicht, der in vergleichbaren bewirtschafteten Wäldern als Vorgabe für die Pflanzung dient (UNSER WILDER WALD Nr. 32/Seite 4).
Schließt die Verordnung die Ausweisung von Naturzonen aus?
Demnach wären keine Maßnahmen der Walderhaltung und -erneuerung erforderlich, um den Hochlagenwald in seiner Substanz zu erhalten und in seiner Funktion zu sichern. Nach Angaben der Nationalparkverwaltung wurden nämlich bei der Hochlageninventur 2012 nur elf Probekreise ohne jegliche Verjüngung gefunden, 149 Probekreise mit mehr als 1000 Bäumchen pro Hektar registriert. Damit habe „die Verjüngungsdichte in den Hochlagen des Falkenstein-Rachel-Gebietes einen Wert erreicht, der in vergleichbaren Wirtschaftswäldern als Vorgabe für die Pflanzung dient“. Dass in 58 Prozent der Aufnahmeflächen (206 Probekreise von insgesamt 355 erfassten Probekreisen) weniger als 1000 Bäumchen pro Hektar gefunden worden sind, wird verschwiegen. Denn diese Flächen sind unzureichend verjüngt.

Mitglieder der Bürgerbewegung bei der Suche nach jungen Bäumchen auf einer der großen Kahlflächen im Wasserschutzgebiet der Trinkwassertalsperre Frauenau.
Nationalparkleiter Dr. Leibl behauptet, dass die Nationalparkverordnung die Ausweisung von Naturzonen im Hochlagenbereich des Falkenstein-Rachel-Gebietes nicht zwingend ausschließe. Er will nicht wahrhaben, dass der Gesetzgeber unmissverständlich verordnet hat, den Hochlagenwald wegen seiner besonderen Schutzfunktionen für den Wasserhaushalt durch geeignete naturnahe Maßnahmen der Walderhaltung und Walderneuerung in seiner Substanz zu erhalten und in seiner Funktion zu sichern. Seinem Vorgänger war klar, dass „Naturzonen“ im Hochlagenwald unzulässig sind – weil die Ausweisung von Flächen, auf die der Mensch keinen Einfluss nimmt, in den Hochlagen verbietet und zu Maßnahmen zwingt, die dem Schutz des Hochlagenwaldes dienen!
Die von der Nationalparkverwaltung vorgeschlagene Naturzonenausweisung in den Hochlagen sei kein Verstoß gegen die Nationalparkverordnung und damit auch kein Rechtsbruch, behauptet Dr. Leibl. Und deshalb will er heuer in den Berglagen zwischen Rachel und Falkenstein auf einen Streich knapp 2000 Hektar Fläche zu Naturzonen erklären. Da drängt sich schon die Frage auf: Ist dieses Vorhaben vereinbar mit der Nationalparkverordnung? Die Antwort darauf hat die Pressesprecherin der Nationalparkverwaltung in ihrer Stellungnahme selbst gegeben:
„Architekt des Nationalparks“ und „Motor der Artenvielfalt“
„Um bis zum Jahr 2027 das vorgeschriebene Ziel von 75 Prozent Naturzone zu erreichen, soll die dafür erforderliche Erweiterung ‚kontinuierlich und in angemessenen Schritten‘ erfolgen, nicht etwa auf einen Streich am Ende der Entwicklungsphase. Das legt die Nationalparkverordnung fest.“ Um den Widerspruch zwischen den gesetzlichen Vorgaben und dem Handeln aufzulösen, soll nun der Nationalplan geändert werden. Die Nationalparkverwaltung betont, dass nur das Umweltministerium zustimmen muss. Dieses Staatsministerium bestätigt auch, dass die Ausweisung von Naturzonen in den Hochlagen rechtmäßig sei. Denn wo der Wald vernichtet ist, habe er keine Schutzfunktionen mehr. Und damit erübrigen sich angeblich auch die vom Landtag verordneten Maßnahmen.
Die Propaganda der Nationalparkverwaltung, dass der Borkenkäfer der „Architekt des Nationalparks“ und der „Motor der Artenvielfalt“ sei, lehnen wir ab. Die verantwortlichen Politiker klagen wir an, dass sie das wertvollste Naturgut unserer Heimat, den Wald, einer widersinnigen Wildnis-Ideologie opfern!“
_____________________
- “Nationalpark-Gegner kann man nicht von heute auf morgen umstimmen”
- “Wir sind keine Nationalpark-Gegner – wir bestehen nur darauf, dass die Richtlinien eingehalten werden”
- Jetzt mal Tacheles: Naturzone, IUCN-Richtlinien & Nationalparkverordnung
- Naturschützer Jens Schlüter: “Der Borkenkäfer ist der Motor der Artenvielfalt”
Hubert Demmelbauer
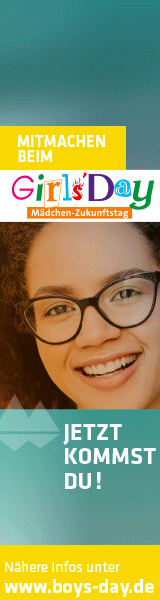













































Nationalpark weiter so! Tacheles ja, aber bitte immer die GANZE Wahrheit.
Wir beneiden Bayern und Südböhmen um ihre Nationalparks und besonders geschützten und dadurch außergewöhnlich schönen Zonen im Böhmerwald! Eine Devastierung und für Jahrzehnte beschädigtes Wald-Ökosystem im österreichischen Böhmerwaldteil, wie es der größte Waldbesitzer der Region von Gottes Gnaden aus Schlägl am und um den Plöckenstein und Hochficht in den letzten Jahren angerichtet hat, ist bestimmt kein nachahmenswertes Unterfangen… Dafür aber auch noch dutzende tausend Euro Steuergelder jährlich für die nächsten hundert Jahre einzustreifen – für eine natürliche Entwicklung der forstlichen Kahlschläge über 1000 m Seehöhe (bzw. forstwirtschaftliche Aussernutzungstellung für die nächsten 100 Jahre!?) ist schon ein Gipfel von Zynismus und grenzt eher an Rechtsverdrehung, als an Respekt vor Natur und Schöpfung, wie in vielen internationalen/europäischen Richtlinien und Papieren festgeschrieben.
Was der Borkenkäfer in den von Nationalparks geschützten Kernzonen in den letzten Jahrzehnten ermöglicht hat (eine natürliche und nachhaltig resistente sowie artenvielfältige Waldverjüngung und Walderneuerung – ganz ohne menschliches Zutun!), hat der forstwirtschaftliche Kahlschlag inklusive sündteurer Wiederanpflanzungsprogramme in angrenzenden Gebieten verhindert. Siehe Plöckenstein und vergleiche die Waldentwicklung dies- und jenseits der Grenzen.
Der Böhmerwald = Bayrischer Wald braucht weder „Wildnis-Ideologie“, noch „Bürgerbewegung zum Schutz“, er braucht lediglich Respekt vor der Natur und den Gesetzen und Zielen eines Nationalparks bzw. der Bewahrung und Erhaltung der Schöpfung und vor allem Zeit für eine natürliche Entwicklung und Fortbestand als eines der schönsten Waldgebiete Europas mit einer wiedergewachsenen Biodiversität, wie man sie selten findet (sogar wieder inklusive Elch, Luchs und Wolf). Forstflächenmonokulturen, sogen. Wirtschaftswald, Tourismusmegaprojekte oder Schilifte haben auch außerhalb eines Böhmerwaldes Platz genug. Leisten wir uns einfach ein letztes Stück Natur (ein Natur-Museum zum „Begreifen“) für unsere Kinder und Enkerl!
Beste Grüße aus Oberösterreich und ein großes Dankeschön für den Nationalpark
Ihr
Josef Pühringer