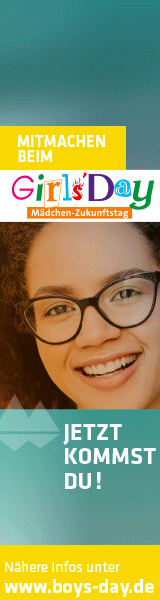Satte 21 Tage hat’s gedauert bis 2015 die ersten Tropfen vom Himmel rieselten. Mehr wie etwas Nieselregen war allerdings nicht drin und so bleibt es hier in Ostuganda vor allem eines: staubig. Verblüffenderweise funktioniert zumindest die Wasserversorgung in meinem Haus ganz gut, ganz im Gegensatz zu anderen Gebäuden. Zwar ist es tagsüber richtig warm, das Schöne an der Trockenzeit aber ist, dass es immerhin nachts ganz angenehm kühl ist. Ich wage zu behaupten, dass mich ein bisschen gefroren hat. Ein ganz klein bisschen. Als kleine Vorsorge gegen die drohende Kälte (angeblich sollen die Temperaturen nachts sogar bis auf unter 20 Grad Celsius fallen), gedeiht mein Bart fröhlich vor sich hin. Das bringt manchmal mit sich, dass das ein oder andere Kind wie angewurzelt auf der Straße stehen bleibt, mit dem Finger auf mich zeigt und laut „Jesus“ ruft. Im Handumdrehen kommen dann sämtliche Kinder angelaufen um die „haarige Wiedergeburt“ zu bestaunen. Ein kleiner Auszug an Reaktionen: – niederknien und ehrfürchtig meine Hand schütteln – wie verrückt auf mich zu rennen und irgendwie ans Bein klammern – wegrennen – wie versteinert da stehen, Mund und Augen weit geöffnet.

Die haarige Wiedergeburt? Johannes Gress‘ (2. Reihe, rechts) Bart wächst und gedeiht – als Schutz vor der Kälte?
Prophet Paul dürfte sich also voll und ganz bestätigt fühlen. Prophet Paul? An dieser Stelle würde ich ganz gern etwas weiter ausholen und über einen Ort berichten, den man wohl als magisch bezeichnen kann. Amber Stores! Eigentlich nichts weiter als ein kleiner Platz mit einer Ansammlung einiger Ramsch-Läden, ein paar Chapativerkäufern und ein paar Boda-Boda-Fahrern.
„Crazy Guys“
Was diesen Platz so besonders macht, sind die Charaktere, die man hier Tag täglich antrifft. Hat man Glück, trifft man um 7.30 Uhr morgens „nur“ auf Priester Jackson. Ein paar Mal Händeschütteln, vielleicht ein paar Umarmungen und kurzer Smalltalk. Dann bekommt man meistens noch gesagt, dass er einen liebt, so wie er eigentlich alles und jeden liebt. Kein großes Ding und vor allem morgens mein persönlicher Favorit unter den sogenannten „Crazy Guys“.
 Eine Nummer härter kommt’s dann schon, wenn man auf Johnson trifft. Er hat einen gewissen Hang zur Hyperaktivität, springt gern wild fuchtelnd um einen herum und redet in einer Geschwindigkeit, dass man bestenfalls ein Viertel der Informationen aufgabelt. Ist aber alles kein Problem, da er sich im Laufe des Gesprächs (besser: im Laufe des Monologs) sowieso mindestens vier Mal wiederholt. Aber aufgepasst, nur den Themenwechsel nicht verpassen, da seine Übergänge für den „Otto-Normalverbraucher“ nicht immer ganz klar ersichtlichen Mustern folgen. Wurde man gerade noch über das afrikanische Klima belehrt, bekommt man im nächsten Moment schon die Lösung für Kenias Al-Shabab Problem auf den Teller serviert, bevor’s dann zügig weiter geht zur Kolonialgeschichte Kanadas. Hat man auch Johnson anständig weggesteckt, kann einen eigentlich nur noch Paul der Prophet aus den Socken hauen.
Eine Nummer härter kommt’s dann schon, wenn man auf Johnson trifft. Er hat einen gewissen Hang zur Hyperaktivität, springt gern wild fuchtelnd um einen herum und redet in einer Geschwindigkeit, dass man bestenfalls ein Viertel der Informationen aufgabelt. Ist aber alles kein Problem, da er sich im Laufe des Gesprächs (besser: im Laufe des Monologs) sowieso mindestens vier Mal wiederholt. Aber aufgepasst, nur den Themenwechsel nicht verpassen, da seine Übergänge für den „Otto-Normalverbraucher“ nicht immer ganz klar ersichtlichen Mustern folgen. Wurde man gerade noch über das afrikanische Klima belehrt, bekommt man im nächsten Moment schon die Lösung für Kenias Al-Shabab Problem auf den Teller serviert, bevor’s dann zügig weiter geht zur Kolonialgeschichte Kanadas. Hat man auch Johnson anständig weggesteckt, kann einen eigentlich nur noch Paul der Prophet aus den Socken hauen.
Er, Prophet Paul, wurde von Jesus persönlich geschickt
Mit Paul kann man eigentlich ganz alltägliche Unterhaltungen führen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er das Gespräch plötzlich unterbricht und wie aus heiterem Himmel anfängt zu predigen. Voller Überzeugung lässt er alle Anwesenden wissen, dass Jesus zurückkehren wird und das in einer Lautstärke, dass auch der Südsudan noch etwas von seiner Prophezeiung hat. Das geht dann für ein paar Minuten so, ohne dass sich irgendjemand groß für das Spektakel interessiert, zum Abschluss bestätigt er nochmal, dass er, Prophet Paul, von Jesus persönlich geschickt wurde, bis er dann im normalen Tonfall, als wäre gerade all dies nicht passiert, seine Unterhaltung fortführt. Wer mit dem Christentum eher weniger am Hut hat und hingegen mehr auf’s Abenteuerliche steht, den kann ich nur „Pollution Paul“ ans Herz legen.
 Zuletzt waren wir zu dritt auf seinem Boda unterwegs den Berg hinunter. Auf halber Strecke kam dann die Information, dass seine Bremsen leider nicht funktionieren. Blöd nur, dass am Ende des Bergs drei schwere Herren mit noch schwereren Gewehren eigentlich vor hatten, eine Kontrolle durchzuführen. Mit richtig Schwung rasten wir auf die drei zu und ich konnte nur noch ein entferntes „Waaaait, stoooop!!!“ hören, als wir endlich zum stehen kamen und etwas kleinlaut zu den drei Securities zurückwateten. In dem Moment war mir ehrlich gesagt mulmig zu Mute, weil ich nicht wirklich einschätzen konnte, wie sie auf diese Aktion reagieren würden. Umso erleichterter war ich dann, als die drei rafften, was los war und lauthals anfingen zu lachen. In die Reihe der „Crazy Guys“ gesellen sich dann noch Eva, die niemals lachende Bier-Frau, der stets randvolle und niemals schlafende Waragi-Typ und ein paar andere lustige Gestalten.
Zuletzt waren wir zu dritt auf seinem Boda unterwegs den Berg hinunter. Auf halber Strecke kam dann die Information, dass seine Bremsen leider nicht funktionieren. Blöd nur, dass am Ende des Bergs drei schwere Herren mit noch schwereren Gewehren eigentlich vor hatten, eine Kontrolle durchzuführen. Mit richtig Schwung rasten wir auf die drei zu und ich konnte nur noch ein entferntes „Waaaait, stoooop!!!“ hören, als wir endlich zum stehen kamen und etwas kleinlaut zu den drei Securities zurückwateten. In dem Moment war mir ehrlich gesagt mulmig zu Mute, weil ich nicht wirklich einschätzen konnte, wie sie auf diese Aktion reagieren würden. Umso erleichterter war ich dann, als die drei rafften, was los war und lauthals anfingen zu lachen. In die Reihe der „Crazy Guys“ gesellen sich dann noch Eva, die niemals lachende Bier-Frau, der stets randvolle und niemals schlafende Waragi-Typ und ein paar andere lustige Gestalten.
Die Bayern sind dem Afrikaner ähnlicher als dem Norddeutschen
Unterhaltung pur, rund um die Uhr, ob man will oder nicht. Ganz allgemein würde ich das Geschehen auf der Straße hier als „interessanter“ bzw „lebhafter“ beschreiben. Die allerwenigsten haben die Mittel, sich einen eigenen Fernseher zuzulegen und die Häuser sind meist nur mit dem Allernötigsten ausgestattet, sodass sie eigentlich nur zum Schlafen und Kochen genutzt werden. Folglich verbringen die Menschen einen Großteil ihres Tages einfach draußen – es wird gequatscht, gelacht und gescherzt. Oft sitzen auch wir abends zusammen und finden irgendeinen Streitpunkt – sei es Religion, Politik, Philosophie oder Geschichte – an den unsere Meinungen deutlich auseinander gehen. Da die scheinbar omnipräsente Google-Schnelllösung (kein Internetzugang!) wegfällt, entwickeln sich fast jeden Tag herrliche Diskussionen. Besonders interessant ist, das völlig verschiedene Nationalitäten und soziale Hintergründe an einen Tisch sitzen (manchmal habe ich das Gefühl, die kulturellen Unterschiede von Bayern und Norddeutschen sind nochmal um einiges größer als die von Bayern und Afrikanern).
So prallen oft kontroverse Weltbilder und Ansichten aufeinander. Und auch wenn nicht immer jeder von uns mit der Meinung seines Gegenübers übereinstimmt, muss er sich zumindest damit auseinandersetzen. Der Lerneffekt liegt also deutlich über dem der (zugegeben deutlich bequemeren) Googelei. Nicht wenige Male müssen wir am Ende einer Diskussion sogar feststellen, dass wir auch ohne Internet auf eine zufriedenstellende Lösung gekommen sind. School of Life!
Letztes Wochenende hab ich mich mit zwei meiner „Muzungu-Kollegen“, die hier in Mbale im Rahmen eines anderen Projekts Entwicklungshilfe leisten, auf den Weg nach Jinja gemacht, um dort das internationale Rafting-Event am Nil zu verfolgen. Etwas außerhalb der Stadt haben wir auf einem Campingplatz eingecheckt und noch ein paar andere bekannte Gesichter aus allen Teilen Ugandas getroffen. Um zum eigentlichen Wettkampfort zu kommen, hatte man die Gelegenheit, einen der angebotenen Shuttle-Busse zu nutzen. Mittlerweile ganz „local-like“ waren wir zu spät dran und so trampten wir zum Wettkampfort. Einen Lift zu finden gestaltete sich nicht allzu schwierig, das primäre Problem war eher der Lift an sich.
Südafrikanerin: „Go ’n get those bloody motherfuckers“
Eine Südafrikanerin, Mitte 40, ausgestattet mit einem Cowboy-Hut und ihrem überaus intelligenten Sohn. Beide hatten das Thema Apartheid noch nicht ganz aufgegeben. In einem weißen Pickup ging’s über staubige und von Schlaglöchern gesäumte Straßen. Fahren musste der Sohn der beiden Möchtegernkolonialherren, da sie ihre Vorliebe zu Heineken nicht unter Kontrolle hatte – und das um drei Uhr nachmittags. Auch wenn uns schon auf den Hinweg beinahe ein paar Hühner und Ziegen unter die Räder gekommen wären, ließ sie sich nicht davon abhalten, ihren Sohn anzubrüllen, er soll mal etwas Gas geben. Richtig friedliche Atmosphäre, schon auf der Hinfahrt – herrlich! Als uns dann auf dem Rückweg (die Gute war auch während der Veranstaltung ihrem Lieblingshopfengetränk treu geblieben) auch blöderweise noch ein anderes Auto überholte, kam mal richtig Stimmung auf – „Go ’n get those bloody motherfuckers“.
 Leid taten mir in diesem Moment nicht nur ihr Sohn, sondern vor allem die fünf anderen Tramper, die auf der Ladefläche Platz nehmen mussten. Sie hatten nicht nur damit zu kämpfen, sich überhaupt auf dem Auto zu halten, sondern bekamen auch den gesamten Staub ab. Komplett in Orange gefärbt kamen wir nach über einer Stunde endlich im Camp an.
Leid taten mir in diesem Moment nicht nur ihr Sohn, sondern vor allem die fünf anderen Tramper, die auf der Ladefläche Platz nehmen mussten. Sie hatten nicht nur damit zu kämpfen, sich überhaupt auf dem Auto zu halten, sondern bekamen auch den gesamten Staub ab. Komplett in Orange gefärbt kamen wir nach über einer Stunde endlich im Camp an.
„Breakfast for Champions“
Die Atmosphäre dort war einfach unbeschreiblich. Direkt am Nil gelegen, konnte man Stunden damit verbringen, den Adlern zuzusehen, wie sie durch die Lüfte schwebten. Im Wasser spiegelte sich die Sonne wider und mittendrin ein paar alte Kanus aus Baumstämmen gefertigt, die friedlich die kleinen grünen Inseln umkurvten. Dazu Leute, hauptsächlich Volontäre, aus allen möglichen Ländern. Beste Voraussetzungen also für eine richtig gute Party. Und die gab es dann auch, bis in die Morgenstunden wurde zu Musik aus den 80ern und 90ern getanzt. Der Preis für die beste Tanzeinlage geht dabei eindeutig an einen Chinesen, der anscheinend aufgrund seiner Hochbegabung mit seinen 25 Jahren bereits an der Kampala-University Mathematik unterrichtet. Tags darauf gab’s dann erstmal das „Breakfast for Champions“, bevor es dann gemütlich wieder zurück nach Mbale ging.
„You whites, you got the watches, but we Ugandans, we got the time“ – in diesem Sinne: Lasst’s Euch ned hetzen, geht ’ses ruhig an!
Liebe Grüße aus Mbale
P.S.: Für alle, die mehr über Uganda und insbesondere seine politische Vergangenheit unter dem „Idi Amin Regime“ erfahren möchten, kann ich nur den Film bzw das Buch „Last King of Scotland“ empfehlen.
–> (1) Ist das Materielle Voraussetzung für ein glückliches Leben? Johannes Gress’ Reise nach Uganda
–> (2) “It’s like an angel pisses in your mouth” – Johannes Gress’ Umwege nach Uganda
–> (3) Uganda calling, oder: Johannes Gress kurz vor seinem großen Ziel
–> (4) Anderes Land, anderer Kontinent, anderer Planet – Johannes Gress’ erste Tage in Uganda
–> (5) Der gesunde Mix aus Planlosigkeit, Gleichgültigkeit und Chaos – der Alltag in Uganda
–> (6) Alltag in Ostafrika: Uganda – das Land der unnormalen Normalität
–> (7) Kinder mit trockenen Lippen und leerem Blick – die andere Seite Ugandas
–> (9) Johannes Gress: “Manchmal macht mich dieses Land einfach unglaublich wütend”
–> (10) Soll Afrika mal so aussehen wie Europa? Ist das das Ziel für alle Entwicklungsländer?
–> (11) Johannes Gress und sein ganz persönliches Osterwunder in Uganda