Eggenfelden. Am Wochenende hat sich Fräulein Weiler einem russischen Klassiker hingegeben: Am Theater an der Rott schaute sie sich „Die Möwe“ von Anton Tschechow an. Drei Stunden dauerte die Aufführung. Drei Stunden, die Fräulein Weiler staunen und lachen ließen, ihr eine heftige Gänsehaut und zappelige Beine bescherten. Warum, das lesen Sie in Ihren Ausführungen …
Keine „schwäääre Kost“ – sondern lauter Lebensthemen
Nach meiner Erfahrung ist das Schauspiel am Theater das Genre, das bei mir am meisten haften bleibt. Die Themen graben sich tief in mein Innerstes ein, weil sie mich immer an irgendeiner Stelle berühren. Das Spiel erreicht mich unmittelbar. Wie so oft gehe ich an diesem Abend unbedarft ins Theater. Ich schäme mich nicht, Ihnen zu sagen, dass ich von Tschechows „Möwe“ keine Ahnung habe. Was nicht heißt, dass ich noch nie mit russischen Klassikern zu tun gehabt hätte. „Anna Karenina“ von Leo Tolstoi hat mich sehr mitgenommen. Dementsprechend stelle ich mich vielleicht auf ein wenig „schwäääre Kost“ ein. Eins kann ich Ihnen aber gleich sagen: „Die Möwe“ zog mich nicht zu Boden. Sie beflügelte mich aber auch nicht. Sie verweilte einfach in meinen Gedanken – mit ihren Lebensthemen von Liebe, Hoffnung und den Leiden, die damit verbunden sind.

Medwedenko (rechts) will was von Mascha. Sorin juckt das nicht. Er freut sich einfach über Gesellschaft.
Nun ja, gänzlich vorbehaltslos bin ich vielleicht doch nicht. Immerhin machte ein gewisser Róbert Alföldi die Tage zuvor in den Medien die Runde – der Regisseur. Er war einst Intendant am Ungarischen Nationaltheater in Budapest. Weil er aber nicht so ist, wie es sich die rechte Regierung vorstellt, wurde sein Vertrag nicht verlängert, heißt es. Eine Möglichkeit für ihn ist die Arbeit im Ausland. Darum inszenierte er in Eggenfelden. Das ist schon ein Ding. Ich bin gespannt. Das weckt Erwartungen.
Alles voller Holz. Naturbelassen. Zwei Wände aus Fichtenbrettern, Nut und Feder. Ein Parkettboden mit Stufen. An den Wänden hängen Körbe mit Asparagus in Reih und Glied. Das Holz glänzt golden. Das Bühnenbild von Ilona Ágnes Tömő wirkt warm, symmetrisch, nüchtern und wartet geradezu darauf, mit Menschenleben ergänzt zu werden. Die Menschen … Sie treffen sich einmal jährlich in diesem Haus am See, auf dessen Weg keinesfalls Orangenbaumblätter liegen. Es geht nicht um dauerhaft erfüllte Träume. Es geht um Sehnsüchte. Um Liebesleiden. Um das Verlangen nach Anerkennung. Und das gestaltet sich auf der Bühne anstrengend und komisch zugleich …
Alle sind verliebt – und stoßen doch nicht auf Gegenliebe

Kostja ist voller Hoffnung. Kann er die Gunst seiner Mutter gewinnen? Und vielleicht auch das Herz von Nina?
Kostja liebt Arkadina. Das ist seine Mutter. Er möchte ihre Aufmerksamkeit, ihre Zuneigung. Er ist jung und sieht gut aus. Und er will ein ernstgenommener Schriftsteller werden. Um bei seiner Mutter zu punkten, zeigt er der Gesellschaft am See ein eigenes Theaterstück. Neue Wege will er beschreiten. Und das tut er: Er träufelt eine Linie Ketchup auf die „Promenade“, an der die Gesellschaft sitzt und das Schauspiel erwartet, zielt mit einem Laserschwert in Luke-Skywalker-Manier auf jeden Zuschauer. Dann der Auftritt der Schauspielerin Nina in weiß: Lange Angoraunterhose, Strickpulli, Schminke und langer Schleier. Voller Inbrunst spricht sie russisch, macht Tiere nach, steigert sich immer mehr hinein, zieht den Schleier durchs Ketchup, trampelt darauf herum. Da lacht die Mutter hellauf. Lächerlich findet sie’s.
Kostja ist entsetzt, bricht das Stück ab. Er ist gescheitert. Sebastian M. Winkler spielt den jungen Mann in Jeans leidenschaftlich und wandelt sich vom wilden in den in sich gekehrten Schreiber mit Seitenscheitel. Er lacht laut, rast über die Bühne, er ist das ungezähmte Leben. Und Kostja hat doch kein Glück mit seiner Berufung und in der Liebe. Seine Mutter nimmt ihn nicht ernst und Nina, der er sein Herz schenken möchte, liebt einen anderen.
Ninas Möwengeschrei ist sehnsüchtig und wahnsinnig sogleich
Nina liebt Trigorin. Trigorin ist der angesehene Schauspieler, der Kostja einmal werden will. Nina ist auch jung und voller Leidenschaften und Hoffnungen. Eine große Schauspielerin will sie werden – und kommt letztlich doch nicht aus der Provinz hinaus. Sie wirft sich Trigorin an den Hals. Doch der hängt an Arkadina. Aline Joers spielt die Nina so heftig, dass sie mir Gänsehaut bereitet. Sie schreit, trampelt durchs Theater, das junge Leben sprudelt aus ihr heraus. Sie wirkt – egal, ob in Jeanskleid, Samtrobe oder Angoraunterhose. Und ihr Möwenschrei bereitet mir Gänsehaut. Da steckt sie drin, diese Sehnsucht – und gleichzeitig ein kleiner Wahnsinn.
Der Wahnsinn spricht auch aus Arkadina. Stephanie Brenner ist herrlich in ihrer Rolle. Sie spielt die Grand Dame, die überkandidelte Diva. Ihre Erscheinung in rotem Abendkleid mit funkelndem Schmuck unterstreicht ihr Spiel. Sie bewahrt Haltung, schlägt elegant die Beine übereinander, lacht glucksend und arrogant, ihrer Aufsteckfrisur entweicht keine Strähne. Und doch lässt sie sich zu einer Albernheit hinreißen, als sie die Aufmerksamkeit des Doktor Dorns auf sich ziehen möchte. Da wackelt sie plötzlich entengleich drollig mit dem Popo, piepst wie ein Küken und vergisst in ihrem albernen Liebeswerben offenbar, wer sie ist. Nämlich die Geliebte von Trigorin. Der ist sich jedoch meistens selbst genug. Er geht ganz auf in künstlerischen Sphären. Freilich ist da die Leidenschaft, die mit Nina auf ihn trifft und freilich ist da Arkadina, von der er nicht loskommt. Markus Baumeister wirkt als Trigorin einerseits maßlos arrogant, andererseits nicht ganz von dieser Welt, vergeistigt und sozial unsicher. Ich kann ihn nicht ganz einordnen – wie meint er sein Spiel?
Dandy, Diva, Schleimer, Biederfrau – die Mischung macht’s

Arkadina ist die Diva der Gesellschaft am See. Mit seinem Theaterstück ist ihr Sohn Kostja bei ihr durchgefallen.
Doktor Dorn liebt keinen so wirklich. Er weiß, er sieht gut aus – und die Avancen der Frauenwelt schmeicheln ihm. Stefan Lehnen gibt den idealen Dandy ab. Sein kräftig meliertes Haar, der Bart, der Hut und der gut sitzende Anzug, sein verschmitztes Lächeln und die tiefe Stimme. Durchaus sexy. Der Frauenarzt weiß, was die Damenwelt will. Darum reagiert er amüsiert auf die Annäherungen von Paulina Schamrajewa, die mit ihrem Mann Sorins Gutshof verwaltet. Besorgt und bieder tritt Paulina dem Arzt entgegen. Ursula Berlinghof gibt die Unzufriedene, Unbeglückte, die Liebe mit Fürsorge verwechselt.
Ihr Mann Schamrajew ist unbekümmert. Die Liebe scheint für ihn keine große Rolle zu spielen. Armin Stockerer dagegen spielt seine Rolle amüsant, er gibt den kriechenden Schleimer, den ungebildeten Gutshofverwalter, der sich nicht scheut, dumme Fragen zu stellen. Stockerer stellt hier wieder einmal seine Wandelbarkeit unter Beweis. Ob der kreuzbrave Ehemann in der Stubenoper „Der varreckte Hof“ oder der gebrochene Mann in „Die Beichte“ – er kann’s halt einfach, wenngleich er in der Möwe nur eine kleine Rolle bekleidet. Ebenso Günter Rainer, der den Gutsherrn spielt. Schon in der „Polnischen Hochzeit“ machte er sich bei mir beliebt als alternder Mann, dem damals nur der Hund und der Wein blieben. Von diesen Zeitgenossen ist in der „Möwe“ nicht die Rede. Aber auch wenn er alt ist, ihm das Hemd aus der Hose hängt, er das Haar mal strubbelig, mal glatt nach hinten gekämmt trägt – Sorin mischt noch kräftig mit. Sein Lachen hallt durchs Theater, seine albernen Kommentare sind herrlich. Diesen Mann muss man einfach mögen.
Packend: Emotionen, Nähe, Längen und Schnulzen
Dann sind da noch Mascha und Medwedenko – zwei, die am Ende das einzige Paar darstellen. Ob glücklich oder nicht, sie haben sich zusammengetan, weil nichts dagegen sprach und weils vernünftig war. Die Tochter des Gutsverwalters heiratete den Lehrer und sie bekommen viele viele Kinder … Mascha wird gespielt von Elisabeth Therstappen. Ein blonder Engel im schwarzen, unförmigen Gewand ist Mascha, gezeichnet von Depression und Gleichgültigkeit. Was hängen bleibt, ist das schmatzende Kaugummikauen, eine Art Wiederkäuen der schlechten Laune. Michael Del Coco ist ein köstlicher Lehrer. So jung und schon so fad. Langweiliger Pulli, ausgewaschene Jeans, Brille. Unbedarft, lieb und drollig wirkt er. Der Mann kann keiner Seele etwas antun.
So verschieden die Gesellschaft in der „Möwe“ ist, so verschieden sind die Schauspieler. Diese Vielfalt allein ist schon unterhaltsam. Das Spiel selbst entspricht ganz der Thematik. Manchmal brechen die Emotionen in rasender Geschwindigkeit heraus, dann ist so viel Leben auf der Bühne, dass ich mich fast mittendrin fühle. Das bewirkt auch die Nähe. Ich sitze ziemlich weit vorne und die Bühne ragt fast bis zur ersten Reihe. Und dann stockt das Spiel, die Schwere und Hoffnungslosigkeit macht sich breit, es wird langsam und ich denke „weiter, weiter“. Ich werde ungeduldig, muss mit den Beinen zappeln – wann nimmt dieses Zähe ein Ende? Sind die Längen absichtlich eingebaut oder doch eher ungewollt? Und dann kippt die Stimmung wieder und die Gesellschaft wippt zu einem Schlager von Roger Whittaker, so soll die Liebe sein, so das Leben, scheinbar heil. Nichts ist heil.
Ein einziges Augenzwinkern: Róbert Alfölfi und seine „Möwe“
Als der Applaus kein Ende nehmen will und schließlich Róbert Alföldi auf die Bühne poltert, verstehe ich. Selten habe ich einen so charismatischen Mann gesehen. Er lächelt, sein ganzes Gesicht strahlt, sein silbergraues Haar macht keinen alten Mann aus ihm, sondern einen sehr lebendigen. Der Regisseur ist ein einziges Augenzwinkern. Und das ist auch „Die Möwe“, wenn er sie inszeniert. Das Leben ist nichts ohne die Liebe – und nichts ist so kompliziert wie die Liebe. Nimm’s mit einem Augenzwinkern, so ist es halt. Und schön ist es ja trotzdem. Mit diesem Gedanken und dem quälenden Möwenschrei von Nina gehe ich sehr müde heim.
Ihr Fräulein Weiler
„Die Möwe“ ist noch am 21., 22. und am 23. Februar am Theater an der Rott zu sehen. Karten gibt es unter 08721-126898-0.
Ach übrigens: Morgen, 22. Februar, lesen Sie auch im Feuilleton der „Passauer Neuen Presse“ im Rahmen einer mit Sicherheit knallhart recherchierten Geschichte über das junge Theater-Phänomen (oder besser: Theater-Phantom?) „Fräulein Weiler“ …

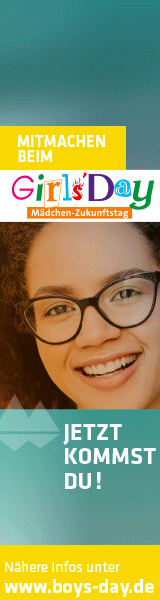














































Einfach nur peinlich dieser selbstverliebte Erguss von Sibelius. Interessiert das auch nur einen Menschen im Woid?
Lieber Herr Heini.
Ich lese die Kritiken von Fräulein Weiler sehr gerne.
Und ich höre auch von anderen Theaterbesuchern, dass sie diese Kritiken sehr schätzen.
Waren Sie selbst in der Möwe ? Und wie hat es Ihnen denn gefallen ?
Um die Kritiken zu schätzen muss man auch nicht im Woid wohnen oder ?
Heini, wie kommen Sie auf die Idee, der Text sei von Intendant Sibelius – der schreibt doch seine Kritiken nicht selber!
Der ist von Fräulein Weiler, steht ja auch drunter. Ich schätze ihre Feder sehr! Und ja, mich interessiert das im Woid.
Sibelius, Gnadenreich oder Weiler, der Name ist doch völlig egal, entscheidend ist, welches Gehirn solche Dinge ausbrütet.
Lieber Herr Heini ,
wie hat es Ihnen denn gefallen ?
Liebe Frau Saliter-Schätzl,
Sie kennen sicher die Folge aus der Serie „Monaco Franze“ in welcher der Protagonist eine Opernaufführung kritisiert. Was er da über diese Aufführung sagt, das könnte man in abgewandelter Form auch über die „Eggenfeldener Möwe“ sagen. Im Übrigen bleibe ich dabei, dass Kritiken von Aufführungen in Eggenfelden die Bewohner des Bayerwaldes nicht mal am Rand tangieren.
Lieber Herr Heini,
ja ich kannte diese Folge. Ich habe sie mir aber zur Auffrischung
gerade angesehen.
Im Umkehrschluss sind sie also der Meinung, dass die unzähligen sehr guten Kritiken die erschienen sind, verkehrt sind. Und Sie nach einem Besuch der Möwe, durch eigenen Augenschein zu einer anderen Einschätzung gekommen sind. Habe ich das so richtig interpretiert ?
Und noch mal mein Hinweis. Da Hogn wird auch von Menschen die weit ausserhalb des Woid wohnen gelesen. Von mir z.b . Ich habe aber auch Bekannte und Freunde die wie ich Wurzeln im Woid haben, und Verwandte und deshalb ihn lesen.,
Welche Dinge denn, ich verstehe nicht, was Sie meinen?
Vielleicht kann das hier ja helfen, die Tarnkappenkritikerin „Fräulein Weiler“ zu verstehen:
Siehe http://www.pnp.de/nachrichten/kultur_und_panorama/kultur/1210123_Jubelkritiken-fuers-Theater-an-der-Rott-Wer-ist-Fraeulein-Weiler.html
Seit einem Jahr bekommt das Theater an der Rott in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) jauchzende Kritiken. Wer sie schreibt, ist ein großes, spannendes Rätsel.
Von so viel Überschwang und Herzenswärme kann jedes Theater nur träumen. Vor einem Jahr, im Februar 2013, fing ein anonymer Autor oder eine anonyme Autorin damit an, ausnahmslos positive, um nicht zu sagen hymnische Kritiken zu schreiben über die Produktionen des Theaters an der Rott in Eggenfelden. Auch unsere Zeitung fand vieles hervorragend. Aber aus der Sicht von „Fräulein Weiler“, so das Pseudonym, feiert das Haus unter der Leitung von Karl M. Sibelius, Intendant seit Herbst 2011, Triumph nach Triumph. Ohne Ausnahme.
„Mir stiehlt sich ein Tränchen aus dem Auge“
„Fräulein Weiler“ schreibt mit feiner Feder, besonders viel Herz − und imitiert die Attitüde des Laien: „Und ab und zu ist das Cembalo auszumachen, dieses alte flügelähnliche Tasteninstrument, Sie wissen schon . . .“ Der Laie darf (im Gegensatz zum professionellen Autor) Beschreibung durch Bekenntnis ersetzen: „In meinem Leben habe ich noch keine solche Stimme live gehört.“ Der Laie darf zum Schlussapplaus frei heraus gestehen: „Mir stiehlt sich ein Tränchen aus dem Auge.“ Um solche Verehrung noch zu steigern, müsste sich ein Autor rhetorisch in den Staub werfen. Er müsste Devotes schreiben wie: „Da stehen elf Multitalente auf der Bühne. Erschaffen alles. Und wer hat es ihnen beigebracht – wer inszenierte den Wahnsinn? Es war Rose Divine, Karl M. Sibelius‘ Alter Ego.“ Moment, das stand neulich ja wirklich in einem Text von Fräulein Weiler.
Fräulein Weiler, von außen betrachtet, ist eine Art größter anzunehmender Verehrer des Theaters und seines Intendanten. Fräulein Weiler, inhaltlich gesehen, formuliert idealtypisch die Quintessenz dessen, was jedes Theater, jeder Intendant, jeder Regisseur und jeder Künstler auf der Welt seinem Publikum gerne vermitteln möchten. Bei Fräulein Weiler zündet jede einzelne Regieidee. Fräulein Weiler versteht alles und liebt alles. Sofern es in Eggenfelden am Theater passiert.
Doch wer ist Fräulein Weiler? Sicher ist zunächst: Fräulein Weiler ist jemand, der Lobeshymnen verbreiten möchte − allerdings nicht unter seiner wahren Identität. Fräulein Weiler ist eine Tarnkappe. Sicher ist auch: Fräulein Weiler schreibt ausführlich, flüssig, ausgesprochen professionell, sagt aber von sich: Ich bin Laie, ich schreibe nur zum Spaß. Sicher ist weiterhin: Fräulein Weiler schreibt unter diesem Namen einzig und allein über das Theater an der Rott. Sie sagt von sich: Ich liebe Theater! Bis ins Landestheater nach Passau reicht die Liebe nicht. Und sicher ist noch: Fräulein Weiler schreibt exklusiv für ein einziges Regionalmagazin. Das Magazin berichtet meist über den Bayerischen Wald, manchmal über Rockbands, und immer übers Theater an der Rott. Eggenfelden ist hier Zweigstelle des Bayerischen Waldes.
Auch die Pressesprecherin schreibt Kulturberichte für das Magazin
Entdeckt hat das Magazin seine Leidenschaft fürs Rottaler Theater am 25. Februar 2013. Wenig später knüpfen das Theater und das Magazin weitere Bande: Seit Juli 2013 schreibt die Sprecherin des Theaters verschiedenste Kulturberichte für das Magazin, am 30. Dezember schließlich berichtet die Sprecherin des Theaters als Journalistin im Bayerwald-Magazin über das Konzert eines iranischen Liedermachers in dem Theater, dessen Sprecherin sie ist. Sie tut dies unter ihrem echten Namen. Ganz anders als Fräulein Weiler.
Vielleicht erhellt sich Fräulein Weilers Identität, wenn man sich ihre erste Hymne noch einmal genauer ansieht: Im sogenannten Quelltext, dort, wo die Verantwortlichen einer Internetseite von Hand alle relevanten Stichwörter auflisten, damit der Text von Suchmaschinen besser gefunden wird, da steht neben vielen anderen Stichwörtern: Theater, Theater an der Rott, dann der Name des Intendanten, dann der Name der Sprecherin des Theaters, dann „Fräulein Weiler“. In dieser Reihenfolge.
Wenn jemand Fräulein Weiler kennt, dann wohl der Geschäftsführer des Magazins, das ihre Texte veröffentlicht. Ja, er kennt sie. Doch er sagt: Die Autorin schreibt nur unter der Bedingung, dass sie anonym bleibt. Warum? Weil sie nicht im Rampenlicht stehen will! Nächster Versuch: Die Kassendamen des Theaters an der Rott müssen Fräulein Weiler kennen, schließlich holt sie dort ihre Pressekarten ab. Doch die Damen sagen: Nein, nie gesehen. Fräulein Weiler reserviert keine Pressekarten, vermutlich kauft sie die Karten privat. Und anonym. Wochen später noch eine Anfrage: Ja, doch, das Magazin aus dem Bayerischen Wald reserviert die Pressekarten. Und Fräulein Weiler holt sie ab? Die Kassendamen schweigen. Und verweisen an die Sprecherin.
Der Intendant ist wütend, und schweigt
Pressesprecher heißen so, weil sie regelmäßig mit Vertretern der Presse sprechen. Doch die Sprecherin sagt: Fräulein Weiler − kenne ich nicht! Die Sprecherin schweigt. Und verweist an den Intendanten. Der Intendant sagt: Ich weiß nicht, wer Fräulein Weiler ist, und es ist mir auch egal. Ein letzter Versuch: Herr Intendant, kennt irgendjemand aus Ihrem Haus die Identität von Fräulein Weiler? Und haben Sie irgendeinen Beleg, dass es sich bei Fräulein Weilers Texten um eine unabhängige journalistische Berichterstattung handelt, die in keinem Interessenverhältnis zum Theater an der Rott steht?
Der Intendant antwortet: Was wollen Sie mir unterstellen? Ich bitte Sie, mich diesbezüglich nicht mehr zu belästigen. Danke. Der Intendant ist wütend, eine Antwort auf die Fragen gibt er nicht. Die nächste Hymne kann kommen.
Top-Journalist und Hobby-Detektiv Meisenberger hat wieder zugeschlagen – ganz große Klasse, wie Sie recherchieren! Doch leider haben Sie das Rätsel noch nicht (ganz) gelöst … Ach wie gut dass niemand weiß, dass ich Fräulein Weiler heiß, gell Herr Meisenberger! Aber Sie kommen da sicher noch drauf – weiter so! Und das Thema bitte immer schön am Köcheln halten ;-)
Es gäbe eine sehr einfache Möglichkeit, jeden ungerechtfertigten Verdacht zu beenden: Einen Kontakt zu dem anonymen Autor, wir unterhalten uns zehn Minuten und dann war’s das. Einverstanden?
Lieber Hog’n, warum schweigen Sie auf die Frage?