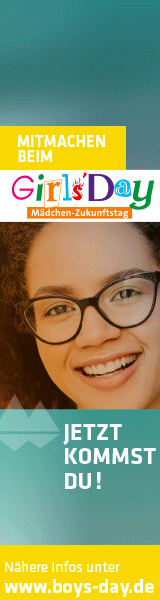Büchlberg/Ruderting. Novak Djokovic, Roger Federer, Maria Sharapova, Serena Williams – Tennisstars, die jeder kennt und denen so mancher Hobby-Sportler nacheifert. Tennis hat sich in den vergangenen Jahrzehnten von einer Elitesportart zum Breitensport für Jung und Alt entwickelt – und wird auch für Menschen mit körperlichen Handicaps immer attraktiver. Eine Diskussion über Rollstuhl-Tennis, neulich bei der Spielerversammlung meines Tennisvereins, hat mich neugierig gemacht: Kann man mit dem Rollstuhl denn auf allen Belägen spielen? Wie ist dieser genau konstruiert? Das mit dem Aufschlag ist doch sicher viel schwieriger als beim „normalen“ Tennis, oder? Fragen, die mir Peter Seidl aus Ruderting, mehrfacher Deutscher Meister und Weltranglistenzweiter im Rollstuhl-Tennis, zu beantworten versucht hat – bei einem mehr als sportlichen Ausprobiat.

Als Fußgänger im Rollstuhl: Peter hilft mir beim befestigen der Gurte und zeigt mir wie ich mit dem Sportrolli umgehen muss.
Direkt neben der Freyunger Tennis-Anlage wohnend und somit quasi mit dem Schläger in der Hand aufgewachsen, muss ich mir eine gewisse Anspannung eingestehen, als ich zur Halle nach Büchlberg fahre. „Der wird Dich ganz schön abzocken – da fliegen Dir die Bälle nur so um die Ohren“, geht mir durch den Kopf. Doch Peters fester Händedruck, sein flapsiger Spruch über meine große Tennistasche und seine sympathische, offene Art lassen meine Bedenken schnell wieder verschwinden. Der 42-Jährige sitzt seit seinem 17. Lebensjahr im Rollstuhl – ein Motorradunfall auf dem Nachhauseweg von der Disko veränderte sein Leben damals schlagartig. Doch aus der Bahn geworfen hatte dieser Einschnitt den Rudertinger nicht: „Ich habe schon als Kind Tennis gespielt. Nach meinem Unfall und einem Jahr im Krankenhaus habe ich im Fernsehen einen Bericht über Rollstuhl-Tennis gesehen. Zusammen mit einem Kumpel haben wir es dann ausprobiert – und es hat auch sofort ganz gut geklappt“, erzählt der Mann mit den markanten Oberarmen und lächelt.
Beim Rollstuhl-Tennis anders: Der Ball darf zweimal aufspringen
Dass das bei mir auch so gut funktioniert, bezweifle ich. Denn schon beim Aufwärmen muss ich ziemlich dagegenhalten, um den platzierten Schlägen des Profis standhalten zu können. Fasziniert beobachte ich anfangs mehr meinen Gegner als mich auf das eigene Spiel zu konzentrieren – bei ihm sieht das alles sehr leicht und dynamisch aus, stelle ich begeistert und mit einer gehörigen Portion Respekt nach einigen Minuten fest. Peter fährt mit dem Schläger in der Hand zum Ball, holt aus, schmettert die Filzkugel mit Spin auf meine Seite, dreht sich danach sofort wieder um und positioniert sich geschickt und wendig zum nächsten Ball.

Peter und sein Sportrolli – ein eingespieltes Team. Mit platzierten und schnellen Bällen scheucht mich der Profi über das Spielfeld.
Weil er mindestens dreimal wöchentlich mit Fußgängern trainiert, belehrt er mich gleich am Anfang mit einem Schmunzeln: „Hau fei gscheit drauf, Daniela!“ Eine Regel ist beim Rollstuhl-Tennis anders als beim „normalen“ Tennis: „Der Ball darf zweimal aufspringen. Beim ersten Mal muss er natürlich im Feld sein, dann darf er auch außerhalb aufkommen. Bei Turnieren springt aber der Ball fast nie zweimal auf, da geht alles sehr sehr schnell“, erklärt Peter geduldig.
Top-Spins: mit gekonnten Schlägen lockt er mich aus der Reserve
Wie zackig das gehen kann, merke ich dann schnell auf Höhe der Grundlinie: Peter verteilt die Bälle, ich renne und gebe mein Bestes – doch er schickt mich mit einem Rückhand-Top-Spin-Schlag auf die andere Seite des Platzes. Seine Beweglichkeit und Flexibilität verdankt er auch seinem maßangefertigten Sport-Rollstuhl, der extra abgeschräge Räder, eine Antikipp-Rolle – und natürlich keine Bremsen hat.
Mit diesem Sportrolli kann Peter auf allen Belägen spielen – ein „schneller“ Untergrund wie auf dem Hartplatz oder in der Halle sind ihm dabei am liebsten. Freilich ist alles auch mit einigen Kosten verbunden, deshalb wäre seine Leidenschaft ohne Sponsoren nicht möglich: der Tennis-Rolli kostetet um die fünftausend Euro, dazu kommen noch Startgebühren, die im dreistelligen Bereich liegen. Bis zu 20 Turniere spielt er jährlich – und das mit großem Erfolg: Unzählige Deutsche und Bayerische Meister-Titel sowie viele internationale Erfolge – sowohl im Einzel als auch im Doppel – konnte er bisher gewinnen. Peter rangiert momentan auf Platz zwei der offiziellen Weltrangliste, wie er mir so ganz nebenbei mitteilt.
Und so sieht’s dann aus, wenn Fußgänger und Rollifahrer gemeinsam Tennis spielen:
Eine herausragende Leistung, die man erst so richtig nachvollziehen kann, wenn man sich sprichwörtlich in die Lage des 42-Jährigen versetzt. Nach einer ersten Kostprobe, was der Deutsche Meister alles so drauf hat, geht’s für mich nämlich ans Eingemachte: Peter stellt mir einen seiner Sportrollis zur Verfügung – und hilft mir nach dem Reinsetzen beim Anlegen der Gurte. Und nachdem ich die ersten Meter mit meinem fahrbaren Untersatz absolviert habe, macht sich schnell ein bedrückendes Gefühl in mir breit: Als Fußgänger in einem Rollstuhl. Irgendwie komisch. Beängstigend. Anders.
Nur sehr langsam komme ich voran, denn den Tennisschläger soll ich Peter zufolge immer in meiner Hand halten. Es gilt das Spielgerät fest zu umklammern und gleichzeitig die Räder anzutreiben. Für ein langsames Dahinrollen reicht meine Kraft in den Oberarmen gerade mal so aus. Jedoch einen Stopp-Ball zu erreichen, der kurz hinter dem Netz auftippt, während ich mich noch an der Grundlinie befinde, ist nahezu unmöglich. Das gesamte Spielfeld erscheint mir aus meiner Perspektive völlig verändert und vor allem noch größer – was ja auch kein Wunder ist, wenn man plötzlich rund einen halben Meter „tiefergelegt“ sitzt. Etwas hilflos und verloren sammle ich die Bälle vom Boden auf und klemme sie zwischen die Speichen der Räder – Peter holt sich in der Zeit, die ich für einen Ball benötige, ganze sechs … auch eine Form der Entdeckung der Langsamkeit.
„Es bringt nichts, sich hängen zu lassen – der Sport hilft dabei sehr“
Peter und sein Rollstuhl sind ein eingespieltes Team. Und es verwundert einen nicht, dass sein Spiel sehr routiniert wirkt. Seit 20 Jahren ist Tennis ein fester Bestandteil seines Lebens: „Es bringt nichts, sich nach einem solchen Schicksalsschlag hängen zu lassen. Der Sport hilft mir dabei sehr.“ Weil er merkt, wie überfordert ich mit der ungewohnten Situation bin, spielt er mir anfangs die Bälle vor die T-Linie. Mit Tennis hat das nicht mehr viel zu tun, was ich da fabriziere – Federball würde da schon eher passen.

Die Rolli-Schläger-Koordination hat’s in sich: Anders als bei Peter ist mein Oberkörper frei beweglich. Dennoch sieht das, was ich bei meinem Selbstversuch abliefere, eher wie Federball aus – und hat mit Tennis nicht viel gemein.
Sobald die gelbe Kugel nicht optimal in meine Richtung kommt und ich ein paar Meter fahren muss, wird es auch schon schwierig. Mein Vorteil: Mein Oberkörper kann sich frei bewegen. Bei Peter muss alle Kraft aus den Armen kommen – ihm fehlt die nötige Bauch- und Rückenmuskulatur. Nach einigen Versuchen schaffe ich es dann doch zumindest jeden dritten Ball zurückzuspielen. An der Grundlinie sehe ich allerdings kein Land: Bis ich denn Ball erreicht habe, ist der schon vier mal aufgesprungen. Mein Respekt für Peters Leistung steigt mit jedem Schlag. Der Grund für seinen Erfolg ist sicherlich auch sein schier unglaublicher Ehrgeiz. Bei einem Schlag ins Netz kommt von ihm sofort ein verärgerter Ausruf. Sein Ziel ist es, wieder die Weltrangliste anzuführen und bei internationalen Turniere siegreich zu sein, sagt er.
Bewegend: „Schön, wenn man wieder aufstehen kann, oder?“
Eine wichtige Voraussetzung dafür: ein guter Aufschlag. Peter zeigt mir, dass er sich dabei mindestens einen Meter hinter der Grundlinie positioniert, um besser auf den Return reagieren zu können. Platziert und mit hoher Geschwindigkeit geht jeder seiner Aufschläge in das gegenüberliegende T-Feld. Von dieser Konstanz kann ich allein als Fußgänger nur träumen – im Rolli ein Ding der Unmöglichkeit. Beim Ausholen stört mich die Armlehne, der Schwung aus den Knien fehlt gänzlich, auch die Bogenspannung ist lässt mehr als zu wünschen übrig. Das Resultat: Nur zwei von mehr als zehn Versuchen gehen übers Netz, der Rest verabschiedet sich bereits davor. Als ich dann probiere Peters Aufschläge zu returnieren, wird erst recht deutlich, wie chancenlos und aufgeschmissen ich bin. Um mich nicht noch mehr zu blamieren, beenden wir das Ganze. Ich schnalle mich ab und steige erleichtert aus dem Rollstuhl.

„I did it“: Erleichtert und um eine wertvolle Erfahrung reicher, steige ich nach dem Ausprobiat aus dem Rollstuhl.
„Schön, wenn man wieder aufstehen kann, oder?“, fragt Peter mit einem Lächeln. Ein Satz, der sich bei mir eingebrannt – und mich sehr bewegt hat. „Wenn ich zum Supermarkt fahre und auf dem Behinderten-Parkplatz jemand steht, der keinen Grund und kein Recht dazu hat, werde ich richtig wütend“, erzählt der 42-Jährige aus seinem Alltag. Verständlich. Denn als ich wieder auf eigenen Beinen stehe, merke ich, wie sehr man diesen „Luxus“, gehen zu können, sich hinsetzen und aufstehen zu können, schätzen sollte – und wie viel Respekt und Hochachtung Menschen wie Peter verdient haben.
Daniela Jungwirth