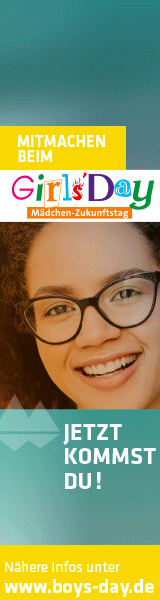Um ein einen neuen Staat zu bilden, schwärmt die Königin aus und sammelt einen Teil des alten Volkes um sich. Diese Völker können vom Imker eingefangen werden. In freier Wildbahn können sich Bienen in Baumhöhlen einnisten. F.: C. Moning
Gerade im Winter beliebt und wohltuend – der Honig aufs Brot, in den Tee oder die heiße Milch. Über ein Kilo Honig konsumiert ein Deutscher im Durchschnitt pro Jahr. Diese Menge wird in mühsamer Arbeit von den Bienenvölkern produziert. Dafür bevorzugen sie „Mischkost“, wie es Imker Jochen Wiecha aus dem Landkreis Regen nennt. Die Blüte der Weide sowie blühende Obstbäume sind für die Völker im Frühjahr besonders wichtig – den Sommer hindurch dann die Blütenwiesen. Da die landwirtschaftlichen Flächen heutzutage oft eintönig sind und intensiv genutzt werden, wird es für die Bienen immer schwieriger den Nektar zu finden.
Im Bereich des Nationalparks Bayerischer Wald fällt auf: die Bienen zieht es in den Wald. Zum einen fliegen sie auf Fichte und Tanne, um dort den Honigtau der Blattläuse einzusammeln. Dieser wird dann zum sogenannten Waldhonig. Zum anderen finden die Bienen gerade in den durch Sturm oder Borkenkäfer entstandenen Offenflächen eine Vielzahl von Blühflächen. Im Rahmen des Biodiversitätsprojektes konnten Forscher des Nationalparks sogar um den Rachel Honigbienen nachweisen, einige Kilometer von der nächsten Siedlung und dem nächsten Imker entfernt. Die vielfältigen Strukturen des naturbelassenen Waldes bieten für Bienen Nahrungs- und Lebensraum. Wilde Völker können sich in den Baumhöhlen einnisten – und auch für die Völker der Imker im Umkreis bieten die Flächen ausreichend „Mischkost“.
Dunkle Biene produziert weniger Honig und gilt als stichfreudig
Jochen Wiecha referierte jüngst über die Honigbiene – ihre Entwicklung, das Sozialgefüge, ihr Verhalten und die Verständigung. Ebenso Thema waren aktuelle Probleme der modernen Imkerei sowie Krankheiten im Bienenstock. Angeregt wurde über das Für und Wider der dunklen Biene, der heimischen Bienenart, diskutiert. Sie wird von Imkern hierzulande (mit wenigen Ausnahmen) nicht gehalten, da sie weniger Honig produziert und als stichfreudig gilt.
Bienen bilden in der kalten Jahreszeit sogenannte Wintertrauben, um sich im Bienenstock warm zu halten. Bei Wikipedia steht dazu geschrieben: „So muss im Winter im Inneren der sogenannten Wintertraube eine Temperatur von ca. 27 °C gehalten werden, an der Oberfläche der Wintertraube darf die Temperatur nicht unter 8 °C abfallen, da sonst die Bienen sterben würden. Die Strategie anderer staatenbildender Insekten (Wespen, Hornissen, Hummeln) besteht dagegen darin, dass das gesamte Volk zum Winter hin abstirbt und nur junge Königinnen in einer Kältestarre überleben. Honigbienen haben dagegen die Fähigkeit, ihre unmittelbare Lebensumgebung zu gestalten, indem sie die erforderliche Nesttemperatur stets aufrechterhalten. Dafür legen sie Honigvorräte an, um stets genügend „Brennstoff“ zur Verfügung zu haben. Sie haben einen anderen Stoffwechsel, eine veränderte Zusammensetzung der Hämolymphe (siehe auch Westliche Honigbiene).
Auch bei minus 20 Grad können die Bienen den Honig aufnehmen
Selbst bei Außentemperaturen bis weit unter −20 °C können die Bienen bei ausreichendem Futtervorrat und einer Individuenzahl von mehr als ca. 5000 den im Innern der Wintertraube erwärmten Honig aufnehmen und damit die notwendigen Körpertemperaturen aufrechterhalten. Der Vorteil der Überlebensstrategie, Honigvorräte anzulegen und den Winter als ganzes Volk zu überleben, liegt darin, dass im nächsten Frühjahr eine große Zahl von Arbeitsbienen sofort das in dieser Jahreszeit reichliche Nahrungsangebot nutzen und die eingetragenen zuckerhaltigen Stoffe zu Honig verarbeiten kann. Durch imkerliche Maßnahmen entstehen zusätzlich Überschüsse, die eine Honigernte ermöglichen.
Für das Überleben des Bienenvolkes ist es notwendig, dass der Imker nach der Entnahme des Honigs im Spätsommer oder Herbst das Volk mit einer ausreichenden Menge Ersatzstoff in Form von Zuckerprodukten versorgt.“
Stefanie Jaeger