Hohenau/Steinbach an der Steyr. „Die Österreicher sind den Deutschen heutzutage in vielen Dingen voraus.“ Ein Satz, den man immer häufiger hört – auch in unserer Region. Die Fortschrittlichkeit und den Weitblick unserer alpenländischen Nachbarn stellte am Wochenende Karl Sieghartsleitner, 70-jähriger Altbürgermeister der 2000-Einwohner-Gemeinde Steinbach an der Steyr in Oberösterreich, eindrucksvoll unter Beweis: Beim Tag der Regionen in Hohenau präsentierte er unter dem Titel „Der Steinbacher Weg: Aufbruch von Innen“ ein interessantes wie nachahmenswertes Konzept zur nachhaltigen Entwicklung ländlicher Gemeinden. Ein gelungenes Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung einer Lokalen Agenda 21. Ein Schlüssel zum Erfolg liegt vor allem in der Wertschätzung und intensiven Beteiligung der Bürger. Es gilt: „Die Menschen miteinbeziehen, sie teilhaben lassen, sie mit in die Verantwortung nehmen.“
Der Steinbacher Weg: ein Weg ganzheitlicher Gemeindeentwicklung
1986 hat die Gemeinde Steinbach a. d. Steyr einen neuen Weg der ganzheitlichen Gemeindeentwicklung begonnen. Unter Beteiligung der Bürger wurde ein Leitbild erstellt, ein Entwicklungskonzept erarbeitet und Projekte mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde im Sinne der lokalen Agenda 21 entwickelt und umgesetzt. Es galt (und gilt immer noch) der Grundsatz: „Wenn wir wollen, dass sich die Bürger auf einen Leitbildprozess einlassen, müssen wir sie für gemeinsame Ziele begeistern.“ Der Leitbildprozess bewirkte eine grundlegende Änderung des Selbstverständnisses der Gemeindepolitik. Die Weichen für einen Übergang vom reinen Verwalten zum vorausschauenden Gestalten wurden gestellt. Im Mittelpunkt standen nicht mehr die Probleme, sondern die Ziele. Die Zukunftsvision: „Wir wollen die Menschen im Ort, Bürger wie Entscheidungsträger, zum gemeinsamen Weg einer neuen Gemeindepolitik einladen, sie dafür begeistern und befähigen.“
Zielsetzung:
Ziel ist die nachhaltige Entwicklung der Gemeinde verbunden mit der Umsetzung der Lokalen Agenda 21. Konkrete Ziele waren die Wiederbelebung des Ortskerns, die Korrektur von Planungsfehlern in der Raumordnung, die Umstellung der Energieversorgung auf nachwachsende Rohstoffe (Hackschnitzel), die Schaffung von geschlossenen wirtschaftlichen Kreisläufen.
Durchführung:
1987 begann eine kleine Gruppe politischer Mandatsträger die Erneuerung der Strukturen der Gemeinde über Parteigrenzen hinweg in Angriff zu nehmen. Dazu wurde ein Leitbild erarbeitet und nach einer klaren Analyse der Situation, der Stärken und Schwächen, ein Entwicklungskonzept für die Gemeinde erarbeitet. Die Erstellung des Leitbildes erfolgte über den Zeitraum von einem Jahr unter Einbeziehung von Bürgern, Vereinen, Institutionen und Körperschaften der Gemeinde. Seitdem wurden mehr als 60 Projekte für eine nachhaltige Entwicklung umgesetzt. Dabei betrifft Nachhaltigkeit die Gemeinde immer als Ganzes: Soziales Miteinander, Arbeiten und Wirtschaften sowie Erhalten des kulturellen Erbes und einer intakten natürlichen Umwelt bilden eine Einheit. Vorteile in einem Bereich dürfen nicht auf Kosten anderer Bereiche gehen. Das Leitbild umfaßt vier gleichberechtige Säulen der Entwicklung:
Dorfgemeinschaft und Lebensqualität: Damit sich die Entwicklungen immer mehr am Menschen orientieren, ist es von vorrangiger Bedeutung, eine neue politische Kultur zu entwickeln, den Selbstwert zu stärken, kreative Kräfte zu wecken und Leistungen anzuerkennen, Betroffene zu Beteiligten zu machen, durch Strukturen der Nähe die Sicherheit und das Wohlbefinden zu verbessern und ein Klima der Verantwortung füreinander zu schaffen (Projekte: u.a. „Grüßen ist cool“, „Ausländerintegration“, „SelbA – Selbständig im Alter“, Frauentreffpunkt)
Kultur und Identität: Um eine Verbindung zwischen Vergangenem und Künftigem zu schaffen, geht es darum, die Wurzeln der eigenen Herkunft zu erkennen und zu bewahren, das Heimatgefühl und die Pflege des Brauchtums zu stärken, die Offenheit für neue Impulse zu fördern, Feste und Feiern als Gemeinschaftserlebnis zu gestalten, das „gewachsene Gesicht“ des Ortes zu erhalten und zu pflegen (Projekte: u.a. Historische Hausbeschilderung, Musikantenstammtisch, Osterbrunnen, Haus-Chroniken)
Arbeit und Wirtschaft: Um die Wertschöpfung im Dorf zu verbessern, strebt man danach, kleine Kreisläufe zu fördern und die eigenen Stärken und Ressourcen nutzbar zu machen, mit Rohstoffen und Energie sparsam umzugehen, die Kooperationen der Wirtschaftspartner zu stärken (Produzenten, Nahversorger, Konsumenten), bei Gütern und Dienstleistungen der Nähe Vorrang zu geben, die Gemeinde als vorbildlichen Haushalt zu führen, eigene Arbeitsplätze zu schaffen und neue zukunftsorientierte Betriebe zu gründen (Projekte: u.a. Steinbacher Dörrobst, Steinbacher Natursäfte und Spezialmöste, Schafprodukte und Bienenhonig Regionalvermarktung)
Natur und Umwelt: Zur Sicherung des natürlichen Erbes geht es darum, die kleinstrukturierte und naturnahe Kulturlandschaft zu erhalten, Zersiedelung vorbeugend zu vermeiden und mit unverbautem Boden sparsam umzugehen, eine naturnahe bäuerliche Landwirtschaft zu erhalten, Ver- und Entsorgung so dezentral wie nötig zu gestalten, den natürlichen Wasserhaushalt zu sichern und zum Klimaschutz aktiv beizutragen (Projekte: u.a. dezentrale Abwasserentsorgung, integrierter biologischer Hochwasserschutz, Renaturierung verrohter Bachstrecken)
Für all diese Themenbereiche wurden ausführliche Ziele formuliert, Umsetzungsaktivitäten und konkrete Projekte sogleich begonnen: wie z.B. die Ortsplatzgestaltung, die Renovierung des alten Pfarrhofs, Erzeugung und Vermarktung von Steinbacher Dörrobst und Natursäften, Bau und Betrieb von Hackgutnahwärmeanlagen (Hackschnitzelheizung), die Umsetzung von Baulandkonzepten und die Umsetzung eines dezentralen Abwasserentsorgungskonzeptes. Die Umsetzung des Leitbildes wird vom Gemeinderat koordiniert, der Stand der Umsetzung einmal jährlich in einer Klausurtagung überprüft. Nach Gemeinderatswahlen wird das Leitbild überarbeitet: dies ist bisher zwei Mal geschehen, Änderungsvorschläge können von allen Gemeindemitgliedern eingebracht werden.
Wirkung:
Die Situation der Gemeinde Steinbach a. d. Steyr hat sich seit 1986 in den Schlüsselbereichen deutlich verändert: Die Abwanderung wurde gestoppt und eine positive Bevölkerungsentwicklung erzielt. Es konnten 124 neue Arbeitsplätze geschaffen werden (+238 Prozent). Die Arbeitslosenquote in der Gemeinde sank von 9 auf 3 Prozent. Zahlreiche Betriebsgründungen führten annähernd zu einer Verdoppelung der Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe von 27 auf 52. Die Landwirtschaft hat eine stabile Struktur und verzeichnet keinen Rückgang. Mehrere Preise und Auszeichnungen wurden erzielt, u.a. der Europäische Dorferneuerungspreis 1994, VCÖ-Preis „Kurze Wege“ 1997 und der Umweltschutzpreis des Landes Oberösterreich 1997. An die 200 Gruppen besuchen jährlich Steinbach a. d. Steyr und lassen sich für die Umsetzung dieser Vision im eigenen Ort inspirieren.

Aufgrund des schlechten Wetters fanden am Samstag nur wenige Zuhörer den Weg in die Hohenauer Veranstaltungshalle.
Vom intakten zum gefährdeten Dorf: Der Niedergang der Strukturen
In den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts begann die Krise in Steinbach an der Steyr. Das Kleinräumige konnte sich zum Weltmarktbedingungen immer schwerer behaupten. Die ländlichen Strukturen wurden in Frage gestellt. Die Konkurrenz durch billige Messer aus Fernost wurde zu groß. Mit dem Konkurs des größten Arbeitgebers in Steinbach, eines Besteckherstellers, verloren 1967 in Steinbach über 200 Menschen ihren Arbeitsplatz. Die örtliche Gewerbestruktur und die Kreislaufwirtschaft begannen zu zerfallen. Eine 20-jährige Niedergangsphase war begleitet von der Aufgabe von Handwerksbetrieben, Geschäften, Gasthäusern und Bauernhöfen. Die örtlichen Kleinbauern verloren ihre Abnehmer. Viele pendelten zu den neuen Arbeitsplätzen, andere wanderten ab. Die Jugend begann in Gunstlagen nahe städtischen Zentren ihre Zukunft aufzubauen. Aufgelassene Industriehallen, leere Geschäfte und Wohnhäuser prägten das Ortsbild. Verstärkt wurde dies durch die Enge der Straßen, die extreme Hanglange des Ortes und die schlechte überregionale Verkehrsanbindung. Resignation, Schwächung der Identität und Verlust von Zukunftsperspektiven. Das Fehlen klarer Ziele war eine der Hauptursachen, dass die Gemeinde zwei Jahrzehnte lang ihre Situation nicht wesentlich verbessern könnte.
Krise als Chance: Von der Selbsterkenntnis zur gemeinsamen Vision
Der Aufbruch zur Erneuerung der Strukturen begann 1987. Eine Gruppe politischer Mandatsträger erkannte, das nur durch gemeinsames Wollen und Handeln die eigenen Gemeinde wieder zum l(i)ebenswerten Lebensraum werden kann. „Es wurde uns klar, dass von außen keine Hilfe zu erwarten war. Entweder wir nehmen das Ruder selbst in die Hand oder es vergehen die nächsten 25 Jahre, ohne dass etwas Neues beginnt“, erinnert sich Sieghartsleitner.
Einer der ersten Schritte war die Erneuerung der Beziehungskultur in der Gemeindepolitik. Dazu hatte man gemeinsam Regeln erarbeitet. Die Fraktionen des Gemeinderates trafen eine Vereinbarung über eine „neue politische Kultur“. Damit trat die Dominanz der Parteipolitik in den Hintergrund. Die meisten Funktionsträger machten mit, einige stiegen aus.
- Die Regeln für eine neue politische Kultur:
- Erfolge werden gemeinsam geteilt
- Ein rücksichtsvoller und toleranter Umgang miteinander wird gepflegt
- Informationen sind für alle gleich zugänglich
- Jeder Beteiligte gibt sein Bestes zur Erreichung des Ziels
- Vielfalt und Verschiedenheit der politischen Kräfte werden respektiert und sichergestellt
- „Patentschutz der Ideen“ wird gewährleistet
Der „Patentschutz der Ideen“ beugt dem „Diebstahl“ guter Ideen vor und schützt damit die Kreativen vor den Unverschämten. Es lohnt, sich und seine Ideen einzubringen. „In Steinbach übernimmt der Bürgermeister die Rolle des Patentanwalts. Er würdigt die Ideengeber aus der Bevölkerung, indem er sie bei öffentlichen Anlässen und Zusammenkünften namentlich nennt – als Ausdruck der Wertschätzung gibt es einen Sonderapplaus für die Kreativität und den Willen sich einzubringen.“
Stärken erkennen, der Entwicklung ein Programm geben

Wenn er dem Vortrag von Karl Sieghartsleitner auch nicht lange beiwohnen konnte: auch Bundestagsabgeordneter Barthl Kalb (rechts) zählte zu den interessierten Zuhörern.
Voraussetzung für neue Wege der Entwicklung ist das Wissen um die eigene Situation. Die Analyse der Stärken und Schwächen der Gemeinde wurde gleichzeitig mit der Leitbilderstellung begonnen und mündete in die Formulierung des Aktionsprogramms. Diese Handlungsanleitung brauchte die Gemeinde, um vom Ist zum Soll zu kommen. Das Entwicklungskonzept war nötig, um die Visionen des Leitbilds in Form konkreter Projekte und Maßnahmen umzusetzen.
„Zu Beginn der Leitbilderstellung bezog sich das Wissen über unsere Gemeinde ausschließlich auf unsere Schwächen. Uns waren die eigenen Stärken und Potenziale nicht bewusst“, so Sieghartsleitner. Zu den verschiedenen Themen wurden Arbeitskreise gebildet. Die Erhebung von Fakten und deren Auswertung erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen Experten und Gemeindebürgern. Durch diese Form der „offenen Planung“ entwickelten sich Gemeindebürger zu „lokalen Experten“.
Bereits während der Analysephase starteten erste Projekte, die bei geringem finanziellen Aufwand kurzfristig realisierbar waren, etwa eine Apfelausstellung oder der Steinbacher Advent. Bei ersterem entdeckten die Steinbacher, dass es lokal mehr als 120 Apfelsorten gibt – und das in einer globalisierten Welt, in der vier Apfelsorten den Markt beherrschen.
Ein externer Moderator begleitete den Prozess. In themenbezogenen Arbeitskreisen wurden Ziele und Maßnahmen festgelegt und umsetzbare Projektideen formuliert. Verantwortlichkeiten wurden festgelegt. Externe Experten wurden nach Bedarf hinzugezogen. Nach einjähriger Arbeit beschloss der Gemeinderat 1989 das Aktionsprogramm. Die Umsetzung des Leitbilds und des Aktionsprogramms wird von einer Steuergruppe, dem Gemeindevorstand, koordiniert. Der Stand der Umsetzung wird einmal jährlich in einer Klausurtagung überprüft. Nach jeder Gemeinderatswahl erfolgt die Aktualisierung. Alle Gemeinderäte und Fachausschussmitglieder werden auf die Einhaltung und bestmögliche Umsetzung des Leitbildes angelobt.
Gemeinsam, praktikabel, innovativ: Klima entscheidet, ob etwas wächst
Ein positives Klima wurzelt im Verhalten des Einzelnen: zum Beispiel Fehler zulassen, andere Meinungen respektieren, bewusst zuhören, Humor haben, Konflikte lösen, Wertschätzung ausdrücken, sich an Regeln und Vereinbarungen halten. Oftmals liegt hier der größte Mangel vor. Ausgehend von den Entscheidungsträgern sind diese Beziehungskompetenzen zu lernen, zu praktizieren und durch vereinbarte Regeln zu untermauern. Ein Klima des Miteinanders wächst, wenn man die Kontakte pflegt. Gemeinschaftserlebnisse tragen dazu bei und schaffen Vertrauen.

„Nachhaltigkeit bedeutet, große Visionen vor Augen zu haben und im Rahmen unserer Möglichkeiten kleine Schritte in die richtige Richtung zu gehen“: Karl Sieghartsleitner und Fritz Denk, Vorsitzender des Verbands für landwirtschaftliche Fachbildung (VlF).
Einbindung der Bürger: Ist er „Untertan“ oder „Partner“?
Bürgerbeteiligung ist eine Frage des Verhältnisses zwischen Entscheidungsträgern und Bürgern. Ist der Bürger „Untertan“ oder „Partner“? Werden die Bürger erst eingebunden, wenn fertige Lösungen bereits auf dem Tisch liegen, kann das zu Konflikten oder zu Frustration führen. Die Einbindung der Bürger zielt auf zwei Bereiche:
- Menschen für eine aktive Mitarbeit in Projekten gewinnen
- Betroffene an Entscheidungsprozessen von Anfang an beteiligen, indem man sie rechtzeitig informiert und Möglichkeiten schafft, ihre Meinung einzubringen und diese auch ernst nimmt. Konflikte können so vorbeugend vermieden werden. Ein externer, unparteiischer Moderator trägt zum Gelingen der Bürgerbeteiligung wesentlich bei.
Konkrete Projekte: „Nicht lange reden, möglichst bald handeln“
Wenn in einer Gemeinde über lange Zeiträume große Visionen diskutiert werden, ohne dass es zu konkreten Schritten kommt, kann Lähmung eintreten. Sobald Klarheit über die Ziele besteht, gilt der Grundsatz: „Nicht lange reden, möglichst bald handeln.“ Dabei gelten folgende Regeln: Projekte klein beginnen und ausbaufähig gestalten; der Vielfalt an Projekten den Vorrang geben; nur jene Projekte beginnen, deren Zeit „reif“ ist; Kooperationen begründen, um Verantwortung und Arbeit aufzuteilen.
Eine erste Zwischenbilanz: 20 Jahre Steinbacher Weg
Nach 20 Jahren (von 1986 bis 2006) konsequenter Arbeit aller beteiligten Kräfte – der politischen Verantwortlichen, der Projektgruppen und der zahlreichen Mitwirkenden – liest sich eine erste Zwischenbilanz des Steinberger Wegs wiefolgt:
- Positive Bevölkerungsentwicklung: Abwanderung gestoppt: von 1.847 Einwohnern (1986) auf momentan mehr als 2.000 Einwohner.
- Neue Arbeitsplätze: 124 neue Arbeitsplätze geschaffen (Zuwachs: über 200 Prozent); Arbeitslosenrate von 9 (1986) auf 3 Prozent (2001) gesunken; 70 Langzeitarbeitslose in Projekte eingesetzt.
- Neue Unternehmen: Kleingewerbe- und Dienstleistungsbetriebe von 27 (1986) auf 52 (2001).
- Revitalisierung der Bausubstanz und des kulturellen Erbes: 15 alte Häuser im Ortskern, Alter Pfarrhof und Fabrikhallen wiederbelebt; 23 Kapellen und 38 Wegkreuze saniert;
- Privatwirtschaftliche Impulse durch die Gemeinde: 5,5 Millionen Euro gezielt in privatwirtschaftliche Projekte investiert (ohne Kanal-, Wasser und Straßenprojekte), die sich durch die Erträge wirtschaftlich selbst tragen
- Beitrag zum Klimaschutz: 1.360 Kilowatt Leistung Biomasse neu installiert, 280.000 Liter Heizöl jährlich ersetzt; in der Versorgung mit Strom aus erneuerbaren Quellen nahezu autark; Klimabündnisziel (minus 60 Prozent CO2 bis 2013 in Sicht).
- Sicherung bäuerlicher Betriebe: Zahl der bäuerlichen Betriebe (109) blieb nahezu konstant; viele Betriebe wirtschaften biologisch; durch neue Einkommensquellen zusätzliche Wertschöpfung in der Höhe von 180.000 Euro jährlich für die Betriebe.
- Bewahren der natürlichen Vielfalt: Sichern von 300 Obstsorten, davon 120 Apfelsorten; Erhalten von 1.000 Hektar naturnahen Streuobstbeständen.
- Ergebnisse einer „neuen politischen Kultur“: Freundschaften zwischen Gemeinderäten unterschiedlicher Fraktionen; konfliktreiche Entscheidungen großteils einvernehmlich und ohne fraktionelle Bindung; hohe Wahlbeteiligung.
- Einbindung der Bürger: 40 Prozent der Bürger arbeiten ehrenamtlich an Veranstaltungen, Projekten und Aktionen mit; 30 Personen für Führungsfunktionen in der Projektumsetzung befähigt und qualifiziert.
- Positive Einstellung zur Zukunft: Im gesamtregionalen Vergleich sind die Zukunftserwartungen der Steinbacher Bevölkerung laut einer Umfrage mit Abstand am positivsten ausgeprägt.
„Kraft zum Beleben und Gestalten der Heimat darf nicht verloren gehen“
Viele Gemeinden und Regionen sind bereits auf dem (Steinbacher) Weg: im Bemühen um eine eigentständige Regionalentwicklung, als Klimabündnismitglied zum Schutz der Ressourcen, in der Dorferneuerung zur Wiederbelebung der baulichen Strukturen oder in der aktiven Beteiligung der Bürger.

Haben sicherlich die ein oder andere wertvolle Anregung mit in ihre Kommune genommen: Mauths Bürgermeister Max Gibis (Mitte, Vordergund) und Freyungs Bürgermeister Olaf Heinrich (Mitte, Hintergrund).
Was ist dann neu am Konzept der Nachhaltigkeit? Neu sind vor allem der Zusammenhang und das Gesamtkonzept. Es geht nicht mehr nur um Teilbereiche, sondern ums Ganze – um die Gesamtheit der Themen und Entwicklungen und um den „roten Faden“, den es zu finden gilt.
Die Agenda 21, das weltweite Programm für Nachhaltigkeit, fordert die Gemeinden auf, in einen Dialog mit ihren Bürgern, örtlichen Organisationen und der Privatwirtschaft einzutreten und eine Lokale Agenda 21, ein Leitbild für eine nachhaltige Entwicklung, zu beschließen und umzusetzen. „Entweder nimmt Nachhaltigkeit auf lokaler Ebene Gestalt an oder sie findet nicht statt.“ Für die Gemeinde Steinbach fügen sich die Erfahrungen mit der umfassenden Erneuerung der Gemeinde zu einem Gesamtbild einer nachhaltigen Entwicklung zusammen. Vieles wurde in Angriff genommen, wie es in der Agenda 21 formuliert ist. Der Steinbacher Weg ist damit auch ein Lokaler Agenda-21-Prozess.
Der Steinbacher Weg: Kennzeichen des Wechsels von der „zufälligen“ zur „nachhaltigen“ Entwicklung:
- von der Sachpolitik zur Wertepolitik: ein neues Wertebewusstsein entwickeln, den Widerspruch zwischen Denken und Tun überwinden; Werte leben und falls notwendig, den Kurs wechseln;
- vom Einzelthema zum gemeinsamen roten Faden: neue Qualität der Zusammenhänge herstellen; ökologisch, wirtschaftlich, sozial, kulturell und geistig entwicklungsfähig bleiben;
- von er Ohnmacht zur Eigenständigkeit: eigene Stärken erkennen und nutzen; den Aufbruch wagen; lokale Innovationen entwickeln; Nähe zum Prinzip machen; die örtlichen Wirtschaftskreisläufe stärken; nicht auf Hilfe von außen warten;
- von der Sorglosigkeit zur Verantwortung im Umgang mit Ressourcen und Möglichkeiten: mit dem natürlichen Erbe, mit Rohstoffen und Energie, mit dem kulturellen Erbe, mit den Menschen, ihren Talenten und Fähigkeiten;
- von der Verwaltungseinheit zur Bürgergesellschaft: Menschen ermuntern, sensibilisieren, begeistern, einbinden, befähigen sowie die Beziehungskultur in der Politik, in der Wirtschaft und im privaten Umgang miteinander erneuern;
„Wir brauchen dringend neue Visionen für das Leben auf dem Land, damit unsere Städte nicht unter den Lasten der Zuwanderung unter die Räder kommen“, so Steinbachs Altbürgermeister Karl Sieghartsleitner. „Die Sehnsucht nach einem geglückten Leben im Einklang mit der Natur muss neu geweckt werden. Die Kraft zum Bleiben und zum Gestalten der Heimat darf nicht verloren gehen, damit wir nicht zu heimatlosen Vagabunden oder zu hilflosen Flüchtlingen auf diesem zunehmend bedrohten Globus werden.“
Stephan Hörhammer
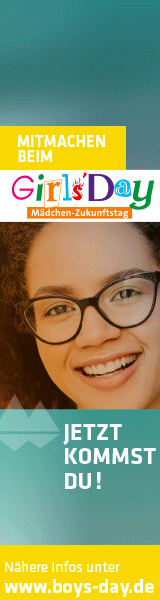















































[…] Dorfgemeinschaft und Lebensqualität: Damit sich die Entwicklungen immer mehr am Menschen orientieren, ist es von vorrangiger Bedeutung, eine neue politische Kultur zu entwickeln, den Selbstwert zu stärken, kreative Kräfte zu wecken und Leistungen anzuerkennen, Betroffene zu Beteiligten zu machen, durch Strukturen der Nähe die Sicherheit und das Wohlbefinden zu verbessern und ein Klima der Verantwortung füreinander zu schaffen […]