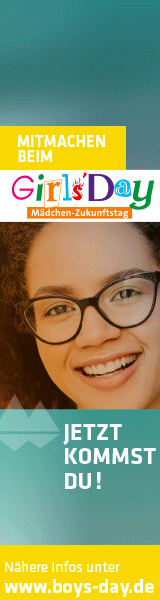Uganda/Deutschland. Die 29-jährige Freyungerin Lotte Heerschop hat es nach dem Abitur an die Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg verschlagen. Während ihres Studiums der Politik- und Wirtschaftswissenschaften hat sie mehrere Auslandsaufenthalte unternommen, unter anderem nach Südafrika und Jemen. Ihr Forschungsinteresse galt dabei immer einer weltweit gerechten Nahrungsverteilung und den Menschenrechten. In Oldenburg hat sie auch im Interdisziplinären Zentrum für Bildung und Kommunikation in Migrationsprozessen (IBKM) mitgearbeitet. Kürzlich war sie für zwei Monate in Uganda, um zu dokumentieren, wie die Bewohner bestehende und künftige Probleme in der Landwirtschaft zu lösen versuchen. Ein kritischer Reisebericht.

Fisch ist nichts für mich: Jim (links) beim Zubereiten des Nilbarsches auf den Ssese-Inseln. Fotos: Lotte Heerschop
„Why are you a Vegetarian? I wish you could become a Christian, just like us!!“ Das fragte mich Jim, als er für mich und meine Begleiterinnen einen Fisch aus dem Lake Victoria zubereitete. Er schüttelte den Kopf, lachte, sah mich an und fuhr fort: „You are full of surprises!“ Wer die Gegend rund um den Lake Victoria kennt, der weiß, dass Vegetarierinnen dort schlechte Gäste sind. Denn rund um den See ist der Nilbarsch das von allen geliebte traditionelle Gericht – und es ist nahezu unverzeihlich, es abzulehnen. Ich tat es trotzdem. Erstens, weil ich seit meiner Kindheit furchtbare Angst habe, an einer Fischgräte zu ersticken. Und zweitens, weil ich bereits vor einigen Jahren in Jemen mein Vegetarier-Dasein für einen Tag aufgeben musste, um eine bettelarme Familie, die extra für eine Freundin und mich ein Huhn geschlachtet hatte, nicht zu enttäuschen.
Tausche bayerischen Winterblues gegen Sonnenland Uganda
Aber jetzt schweife ich ab. Ich wollte ja über Uganda schreiben. In der „Perle Afrikas“, wie Winston Churchill das zentralafrikanische Land einst nannte, verbrachte ich die letzten zwei Wintermonate. Während Ihr vermutlich in der bayerischen Kälte noch den Winterblues gesungen und Euch sehnsüchtig auf den Frühling eingestellt habt, war ich bereits im Flieger und sollte fast punktgenau am Äquator landen. Das ist dort, wo die Sonne immer scheint und man nie einen Pulli anziehen muss. Es ist aber auch dort, wo die Malaria wütet und immer noch knapp die Hälfte aller Kinder mangelernährt sind.
Mit einer Malariaprophylaxe und zwei, wie sich später herausstellen sollte, wirkungslosen Mückensprays im Gepäck, kam ich in Uganda an und wurde von Bob Kasule, meinem Gastgeber, abgeholt. Auf Bobs Biobauernhof in dem kleinen Dorf Naggalama sollte ich nun in den nächsten zwei Monaten leben, essen und auf dem Hof mitarbeiten – inklusive Unkraut jäten, Boden umgraben und Schweine füttern. Gleichzeitig sollte mich meine Filmkamera an viele unterschiedliche Orte begleiten, um zu dokumentieren, wie die Ugander bestehende und zukünftige Probleme in ihrer Landwirtschaft zu lösen versuchen. Dabei traf ich schließlich auch auf Edie Mukiibi – aber dazu später …
Willkommen im Paradies? Ja, wären da nicht die Probleme…
Nur nach Uganda zu fliegen, um meiner alljährlichen Winterdepression zu entfliehen, war mir also zu wenig. Auch wenn ich zugebe, dass meine Wahl in der Regel vorzugsweise auf ein sonniges Land fällt. Nach endlos vielen Gesprächen mit anderen Weltreisenden waren wir uns immer einig: Auf der südlichen Hälfte der Erdkugel sind die Menschen entspannter, das Leben auf den Straßen vibriert und Uhren sind hier allenfalls ein nettes Modeaccessoire.
Auszeit vom kalten Individualismus und grauen Wintertagen also. Willkommen im Paradies? Ja vielleicht, wenn man die Fähigkeit (und vielleicht nicht ganz unwichtig: das Geld) besitzt, die tristen Seiten Ugandas zu ignorieren. Man beschäftigt sich ja trotzdem mit den Problemen der Einheimischen, schüttelt den Kopf über die vielen Kinder, die weder zu essen haben noch zur Schule geschickt werden können – und verschenkt die einen oder anderen Almosen. Aber dann gibt es ja noch Wildwasserfahrten, Bungee-Jumping und die letzten 700 Berggorillas. Und mal ehrlich: Was können wir schon dafür, dass die Leute in diesem Land so arm sind?
Die triste Seite Ugandas: „Models für Hilfsprojekte“
Eine der tristen Seiten Ugandas wird von den zahlreichen unter- und mangelernährten Kindern repräsentiert. Jeder Deutsche kennt sie, zieren sie doch auf zahlreichen Bildern die Werbeplakate der internationalen Hilfsorganisationen. Zynisch gesagt: Sie sind die besten „Models für Hilfsprojekte“, die kleinen dunkelhäutigen Kinder mit ihren großen Hungerbäuchen und noch größeren, sehnsüchtigen Augen. Wangari Maathai, Nobelpreisträgerin aus Kenia, stößt sich wohl zu Recht an der Vermarktung der Armut in Afrika. Denn was sich in den europäischen Gehirnwindungen breitgemacht hat, ist das Bild des hungernden Kindes.

Kato, unser Nachbarsjunge beim Zerlegen einer Jackfrucht. Der Jackfruchtbaum wächst wild in Uganda. Seine Früchte haben einen sehr hohen Anteil an Vitamin C und A.
Des Kindes, das verlassen und bedürftig in einer afrikanischen Gesellschaft aufwächst. Das Sinnbild einer Gesellschaft, die sich selbst nicht zu helfen weiß und ihren Kindern keine Zukunft bieten kann. Vor allem nicht in einer sich rasant globalisierenden Welt, in der die reichen Kinder der nördlichen Halbkugel die Bildung und das Geld haben (geht es doch auch so schön Hand in Hand), um sich im Dschungel der sich globalisierenden Wirtschaft die besten Plätze zu sichern. Zumindest die Besten unter ihnen.
Uganda könnte die Brotkammer Ostafrikas sein, wenn…
Tatsächlich steht man in Uganda vor einem Paradoxon, wenn man die hohe Zahl der unter- und vor allem mangelernährten Kinder betrachtet. Denn in einem Land, das nach Angaben der Food and Agriculture Organizations of the United Nations (FAO) sieben Mal sich selbst und zweimal ganz Ostafrika ernähren könnte, mangelt es nicht an Ressourcen. Wo also liegt das Problem? Weshalb sind immer noch so viele Kinder mangel- und unterernährt?
Dafür ein oder zwei Gründe anzugeben würde der Komplexität des Problems nicht gerecht werden, aber ein entscheidender Grund ist die negative Haltung gegenüber der Feldarbeit. So erzählt mir Marie, die Cousine von Bob, dass sie sich schämt, wenn jemand sie im Garten arbeiten sieht. Die abwertende Haltung gegenüber der Feldarbeit mag auch ein Relikt aus der Kolonialzeit sein: Männer und Frauen aus Uganda waren lange Zeit gezwungen, als Sklaven auf den Kaffee- und Teeplantagen der Engländer zu schuften. Gleichzeitig ist die Entwicklung in Uganda wie überall auf der Welt: Wer will heute schon Bauer sein?
Auch in den Schulen Ugandas wurde diese negative Einstellung kräftig unterstützt, indem Fehlverhalten stets mit Gartenarbeit bestraft wurde. Oft sinnlose Arbeit, wie etwa das Umgraben eines Busches oder das Ausheben einer Grube, die keine Funktion hatte, wie mir Edie Mukiibi erzählt.
Beim Kaffeeklatsch mit Michelle Obama nachhaltiges Konzept vorgestellt
Aber Edie Mukiibi widersetzt sich all diesen Vorstellungen. Edie ist 27 Jahre alt, Ugander, ein Jahr jünger als ich, und hat es letztes Jahr schon zu einem Besuch ins Weiße Haus geschafft, um mit Michelle Obama einen Kaffee zu trinken. Worüber sie gesprochen haben? Hauptsächlich über die Verschwendung von Lebensmitteln in Amerika, erzählt mir Edie, wobei Frau Obama ihn gefragt habe, wie man dagegen vorgehen könne. Denn Edie ist ein Experte, wenn es darum geht, die Rädchen in einer Gesellschaft zu Gunsten einer nachhaltigeren Versorgung mit Lebensmitteln zu drehen. So hat er in Uganda ein pädagogisches Konzept entwickelt, das durchaus auch in Deutschland Potenzial hat.
Kinder als Ausgangspunkt für den sozialen Wandel
Der Absolvent der Agrarwissenschaften nennt das von ihm entwickelte DISC-Projekt (Developing Innovations in School Cultivation) liebevoll sein „brain child“, das ihm besonders am Herzen liegt. Und im Mittelpunkt stehen die Kinder. Kinder, die nicht zu vergleichen sind mit den hilfesuchenden, großbäuchigen Kindern auf den Werbeplakaten der internationalen Hilfsorganisationen. Nein, diese Kinder werden durch das Projekt zu entscheidenden Akteuren, die die Schaufel selbst in die Hand nehmen. Sie sollen der Ausgangspunkt sein für einen tiefgreifenden Wandel.
Worum es in dem Projekt geht? Das Interesse der Kinder für gesundes, traditionelles und sauberes Essen zu wecken. Ihnen beizubringen, weshalb und wie ein kleines Stück Land reicht, um für eine große Anzahl von Menschen gehaltvolle Nahrung anzubauen, ohne den Boden dabei zu zerstören. Edie und sein Team setzen dabei auf den Einsatz von Mischkulturen: so müssen keine Pestizide eingesetzt werden – und auf winzigen Parzellen Land entsteht eine Vielfalt unterschiedlichster Pflanzen. Vor allem grünes Gemüse steht hoch im Kurs: Gemüse, das traditionell angebaut wurde und wichtige Vitamine enthält, im Laufe der Zeit jedoch von den Feldern und aus den Kochtöpfen Ugandas verschwunden ist.
Wissen über die Landwirtschaft nachhaltig weitergeben
Beim Anbau alleine bleibt es nicht: Die Schüler ernten, verarbeiten und kochen die landwirtschaftlichen Produkte. Sie lernen, welche Pflanzen eine positive Wirkung auf die Gesundheit haben – zum Beispiel werden viele Produkte angebaut, die gegen Bluthochdruck und Malaria helfen. Die Praxisnähe und die Freiwilligkeit der Teilnahme an dem Schulgartenprojekt haben dabei höchste Priorität. Denn die Kinder sollen Spaß daran haben, stolz auf ihre Arbeit sein und ein positives Verhältnis zur Landwirtschaft aufbauen. Somit trägt das Projekt Werte wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Nahrungsmittelsicherheit in die Schule. Es geht eben nicht immer nur um Quantität, sondern auch um Qualität, wie Edie mir erzählt – sein Ansatz ist anspruchsvoll und zukunftsträchtig.
Denn das Projekt soll Kinder auch dazu bewegen, an ihre Eltern das Wissen und die Begeisterung für die Landwirtschaft weiterzugeben und zu Hause ihre eigenen Gärten zu bewirtschaften. Das Team um Edie fördert bewusst die Ausbreitung der Gärten über die Schule hinaus und besucht die Ortschaften, in denen sie leben, um dort gemeinsam mit den Eltern gemeinschaftliche Gärten zu planen. Je größer und vielfältiger der Anbau, desto mehr Sicherheit vor Hunger und Mangelernährung.
Schüler sind stolz auf das, was sie angebaut haben
Wie erfolgreich das Konzept ist, konnte ich mit eigenen Augen verfolgen: Die Kinder, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, die ich in dem Projekt getroffen habe, waren alle mit Begeisterung aktiv. Der Schuldirektor der Kiteezi Integrative School, Gimei William, erzählt mir, dass die Schüler stolz auf die Fruchtbäume und Gemüsepflanzen sind, die sie angebaut haben. Einige geben ihren Pflanzen sogar Namen und sie können es kaum erwarten, wenn die Schulferien vorbei sind und sie sich wieder ihren Pflanzen widmen dürfen. Es ist eben ihr Projekt – es sind ihre Früchte, ihr Eigentum und damit ihre Entscheidung, was damit gemacht wird. Das Projekt vermittelt Eigenverantwortlichkeit, Respekt vor dem landwirtschaftlichen Beruf und ein Gefühl für die Natur.
Wie ist das eigentlich bei uns in Deutschland?
Vor allem lehrt es die Kinder in Uganda, dass die Produktion von Nahrung mit viel Arbeit und knappen Ressourcen verbunden ist. Attribute, die uns vor allem auch in Europa verloren gegangen sind. Längst spazieren wir – sogar auf dem Land – in einen großen Supermarkt und suchen in den Regalen nach der preisgünstigsten Ware. Wie zum Beispiel Billigobst aus Spanien, angebaut in riesigen Gewächshäusern, die eine große Menge des spärlichen Grundwassers aus den spanischen Böden pumpen. Oder günstiges Fleisch aus der Massentierhaltung, für die der brasilianische Regenwald abgeholzt wird. Denn unsere Kühe brauchen Futter, das man aus dem Süden bekanntlich günstiger erhält.
Vielleicht sollten unsere Schulen Edies Konzept auch übernehmen: kleine Schulgärten, in denen unsere traditionellen und an die Natur angepassten Sorten angebaut werden. Das Interesse der Kinder dafür zu wecken, was sie essen, wo es herkommt und wie es produziert wird. Denn während wir alle Bananen, Ananas und Mangos kennen und lieben gelernt haben, die in südlichen Ländern angebaut und importiert werden müssen, gerät das einheimische Obst längst in Vergessenheit. Aus einem derartigen Projekt könnten somit auch unsere Kinder eine wichtige Lehre ziehen: Dass es fairer, gesünder und umweltfreundlicher ist, wenn auch wir uns um unser eigenes Essen kümmern.
Lotte Heerschop